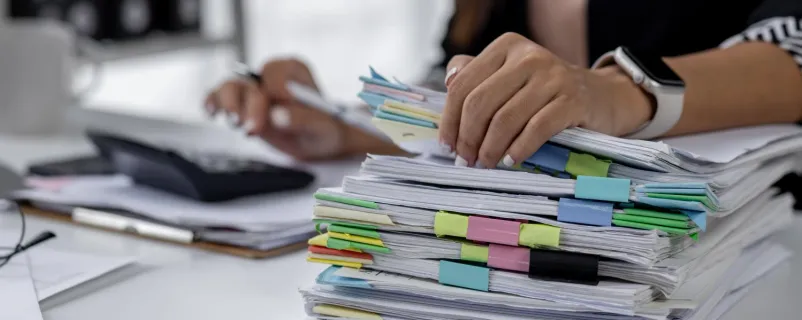
© David - stock.adobe.com
Deregulierung in aller Munde
Die budgetäre Situation zwingt die Politik auf allen Ebenen Reformen umzusetzen, Effizienzpotentiale zu heben und Deregulierungsmaßnahmen zu ergreifen. Vorschläge dazu liegen nicht nur in den Schubladen, sondern auch auf dem Tisch.
In der Vergangenheit wurden nicht selten große Reformvorhaben angekündigt, ausgearbeitet und letzten Endes nicht oder nur zu einem geringen Teil in Umsetzung gebracht (Österreich Konvent).
Grundlegende Struktur-, Staats- und Verfassungsreformen wären zwar auch jetzt zu begrüßen, in Anbetracht der budgetären Lage sollte aber der Fokus auf schnell umsetzbare Projekte gerichtet werden. Große Reformen, die freilich auch nicht aus den Augen verloren werden dürfen, brauchen Jahre für die Ausarbeitung, Jahre für die Umsetzung und letzten Endes Jahre, um ihre Wirkung zu entfalten. Ein Gebot der Stunde ist es daher, zügig die bereits existierenden Reform- und Deregulierungsvorschläge aufzugreifen.
Reform und Deregulierungsvorschläge liegen auf dem Tisch
Um rasch Ergebnisse mit den gewünschten Effekten zu erzielen sind vor allem viele kleine Reformen gefragt, die sich zügig umsetzen ließen. Der Österreichische Gemeindebund hat in den letzten Jahren zu unterschiedlichen Themenbereichen eine Reihe von Reformpapieren und auch zahlreiche detaillierte Deregulierungsvorschläge erarbeitet. Es handelt sich dabei überwiegend um kleine Reformen, jedoch mit großer Wirkung (Auszug):
Eintragungszeitraum bei Volksbegehren
Die letzte „Eintragungswoche“ (Montag 31. März 2025 bis Montag 7. April 2025 werktags von 8.00 bis 16.00 Uhr, einmal bis 20.00 Uhr) hat einmal mehr gezeigt, dass von Seiten der Gemeinden ein immenser und zugleich unnötiger Aufwand betrieben werden muss.
So hat eine Gemeinde mit 7.200 wahlberechtigten Personen berichtet, dass ganze 15 Unterschriften von Bürgern vorgenommen wurden - keine einzige davon außerhalb der regulären Parteienverkehrszeiten. In einer anderen Gemeinde mit rund 6.000 Einwohner waren es trotz Informationskampagnen(!) unglaubliche 2 Unterschriften – auch diese ausschließlich während der Parteienverkehrszeiten. Auch gibt es Gemeinden, in denen nicht eine einzige Eintragung vorgenommen wurde.
Stellt man die Öffnungszeiten von Gemeindeämtern den zwingenden Eintragungszeiten gegenüber, dann ergibt sich nicht selten, dass Gemeinden nur für die Abhaltung von Volksbegehren zusätzlich 20 und mehr Stunden das Gemeindeamt offenhalten müssen – nicht etwa, weil der Bedarf an langen Öffnungszeiten für Eintragungen gegeben ist, sondern schlicht, weil es das Gesetz so will.
Die Volksbegehren in den letzten Jahren waren geprägt davon, dass die meisten Unterschriften nicht in der „Eintragungswoche“ abgegeben wurden, sondern in dem bis zu zwei Jahre andauernden Unterstützungszeitraum (Unterstützungserklärungen). Darüber hinaus erfolgen die Unterstützungserklärungen zu einem weit überwiegenden Anteil online (bis zu 90 %). Der Eintragungszeitraum gehört daher deutlich verkürzt (und zwar auf die jeweils bestehenden Parteienverkehrszeiten!) oder aber überhaupt analog zur Europäischen Bürgerinitiative und mit Blick auf den langen Unterstützungszeitraum gestrichen.
Eichpflicht von Personenwaagen an Schulen
Allein die Tatsache, dass die im Rahmen der schulärztlichen Untersuchung verwendeten Personenwaagen überhaupt eichfähig sein müssen, ist an sich schon absurd. Letztlich geht es um Waagen, die nur einmal im Jahr bei der schulärztlichen Untersuchung im Einsatz sind, um eine ohnedies auch mit freiem und geschultem Auge eines Mediziners sichtbare Über- oder Untergewichtigkeit des Schülers festzustellen. Kosten einer Personenwaage mit Kalibrierungsbestätigung für die Eichung: rund 600 Euro.
Dass diese Personenwaagen aber dann auch noch alle fünf Jahre um teures Geld nachgeeicht werden müssen, klingt wie ein Schildbürgerstreich. Kosten der Eichung der Schulwaagen an den Pflichtschulen alle 5 Jahre: über eine Million Euro. Anstatt die Schulwaagen (die bislang nicht ausdrücklich geregelt waren) explizit aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes auszunehmen, hat der Gesetzgeber aufgrund eines Anlassfalles (Anzeige gegen eine Gemeinde) die Schulwaagen im Jahr 2017 (erstmals) explizit in das Gesetz aufgenommen (!)
Die Eichpflicht der Schulwaagen ist geradezu ein Synonym dafür, dass bis dato selbst die augenscheinlichsten und einfachsten Reformen gar nicht so sehr den fehlenden Mut als Gegner hatten (das wäre noch irgendwie vertretbar), sondern schlicht den fehlenden Willen.
Gebühren für Standesämter
Gemeinden sind es an sich gewohnt, dass sie für den Bund Gebühren in Angelegenheiten einheben, hinsichtlich derer sie den eigentlichen Aufwand zu tragen haben. Auf die Spitze treibt es die Gebührensituation im Personenstandswesen.
So erhalten Gemeinden bzw. die Standesämter etwa für eine Trauung durch den Standesbeamten (im Amtsraum während der Dienststunden) eine Gebühr in Höhe von 5,45 Euro – sehr wenig Geld für mächtig viel Arbeit. Seit Jahren wird eine Anpassung der Gebührensätze im Personenstandswesen gefordert, da diese seit den 70er-Jahren (!) nicht angetastet wurden. Die letzte Anpassung der Gebührensätze erfolgte im Jahr 2002 im Zuge der Euroumstellung (Aufrundung auf die zweite Dezimalstelle).
Wofür und weswegen der Bund nach Gebührengesetz aus diesem Titel („Eheschließung“) gleichzeitig 50 Euro kassiert und für den Fall, dass im Rahmen der Ermittlung der Ehefähigkeit eine ausländische Urkunde im Spiel ist, gleich noch einmal 80 Euro, ist weder nachvollziehbar noch sachgerecht, denn diesen Gebühren steht gar kein Aufwand des Bundes gegenüber – diesen tragen nämlich ausschließlich die Gemeinden.
Und so kommt es, dass entgegen dem Grundsatz der Gebührenäquivalenz (kostendeckende Einhebung von Gebühren) der Kostendeckungsgrad der Standesämter nur mehr bei rund 15 % liegt. Der Rest muss aus dem allgemeinen Budget der Gemeinden finanziert werden.
Auflegung des Wählerverzeichnisses und Hauskundmachungen
Die Auflegung der Wählerverzeichnisse bzw. die Ermöglichung der Einsicht verursacht trotz Wegfalls des Samstags hohe Kosten, da eine Einsichtnahme auch außerhalb der normalen Arbeitszeit ermöglicht werden muss. Nachdem ohnedies niemand physisch Einsicht nimmt und eine Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis mittels qualifizierter elektronischer Signatur ermöglicht wurde, sollte die physische Einsichtnahme auf die Amtsstunden beschränkt werden.
Darüber hinaus müssen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern vor dem Beginn des Einsichtszeitraums in jedem Haus an einer den Hausbewohnern zugänglichen Stelle (Hausflur) eine Kundmachung anschlagen. Nachdem weder ein Sinn noch ein Nutzen, sondern einzig ein Aufwand darin erkennbar ist, sollte diese Pflicht ersatzlos gestrichen werden.
Abgabeneinhebung für Strafregisterauszüge
Viel Einsparpotential wäre auch durch eine Reform des Gebührenwesens zu heben – durch Straffung, durch Pauschalierung und durch Streichung von Kleinstgebühren sowohl im Gebührengesetz als auch in der Bundesverwaltungsabgabenverordnung (allein Letztere umfasst 453 Tarife).
Abgabenvorschriften sind kompliziert und im Bereich der Strafregisterauszüge im Besonderen. Gemeinden, die derartige Auszüge auszustellen haben, müssen sich allein in dieser Angelegenheit mit bis zu vier Gebühren auseinandersetzen (Zeugnisgebühr, Eingabengebühr, Beilagengebühr, Bundesverwaltungsabgabe).
Die Gemeinden haben aber nicht nur den Aufwand, sie haben auch den Ärger, denn von den Gebühren erhalten sie ausschließlich die Bundesverwaltungsabgabe in Höhe von 2,10 Euro. Den Rest der Gebühren, die die Gemeinden einzuheben haben, erhält der Bund (14,30 Euro; 3,90 Euro).
Alles pädagogische Personal in eine Hand
Seit Jahren ist für alle Ebenen klar, dass die Personalbereitstellung im Pflichtschulbereich (im Übrigen auch im elementarpädagogischen Bereich) dringend reformiert werden muss - von den Zuständigkeiten angefangen (Bund, Länder, Gemeinden), über die Finanzierung (Transfer-Dschungel) bis hin zur Administration dieses Personals (Akquirierung, Auslastung, Besoldung, Dienstrechte).
Sogar im FAG-Paktum 2024 hat man sich auf ein politisches Ziel geeinigt. Demnach soll(te) zum Beginn des Schuljahres 2025/26 „das gesamte pädagogische Personal an Pflichtschulen bei einem Dienstgeber (Länder) zusammengeführt und damit eine Reform der schulischen Tagesbetreuung mit einem langfristig stabilen Finanzierungsmodell aus dem Stellenplan für Pflichtschulen erreicht werden“.
Zwar sind die Gespräche und Verhandlungen in der letzten Legislaturperiode schon sehr weit fortgeschritten gewesen und gab es bereits erste Gesetzesentwürfe für eine Zusammenführung – zu einer Beschlussfassung ist es aber nicht gekommen. Nachdem die Zuschussmittel aus dem Bildungsinvestitionsgesetz spätestens im nächsten Jahr endgültig nicht mehr reichen werden, sollte rasch an einer Lösung gearbeitet werden.





