
In den letzten Jahren hat der Gemeindebund sein Engagement auf europäischer Ebene weiter intensiviert. Unter der Führung von Präsident Johannes Pressl, der seit Februar 2024 im Amt ist, wurden zahlreiche Initiativen gestartet, um die Rolle der österreichischen Gemeinden in Europa zu stärken. Beispielsweise betonte Pressl bei den Kommunalen Sommergesprächen 2024 die Notwendigkeit gemeinsamer und starker Antworten Europas in Bezug auf Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum.
© ratatosk- stock.adobe.com
Ja zur Europäischen Union, nein zur Bürokratie
Der Österreichische Gemeindebund war und ist eine treibende Kraft in der europäischen Kommunalpolitik. Bereits in den 1950er-Jahren setzte er sich als eine der ersten nationalen Kommunalorganisationen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gemeinden ein. Und dennoch werden kritische Stimmen immer lauter.
Mit dem frühen Beitritt zum Rat der Gemeinden Europas (RGE) im Jahr 1952 (man beachte: Österreich war damals noch vierfach besetzt) spielte der Gemeindebund eine Pionierrolle und trug maßgeblich zur Verankerung kommunaler Interessen auf europäischer Ebene bei. Diese aktive Rolle prägt den Gemeindebund bis heute – als Stimme der österreichischen Gemeinden auf europäischer Ebene.
Das Engagement des Gemeindebundes ist keineswegs „einfach so dahingesagt“. Während die österreichische Bundesregierung in den 1950er-Jahren noch mit den Verhandlungen über den Staatsvertrag und die Wiedererlangung der Souveränität beschäftigt war, übernahm der Österreichische Gemeindebund bereits 1952 eine Vorreiterrolle bei der europäischen Integration. Als eine der ersten nationalen Kommunalorganisationen trat der Gemeindebund dem Rat der Gemeinden Europas (RGE) bei – einem internationalen Netzwerk zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen europäischen Gemeinden.
Dies war keineswegs eine Selbstverständlichkeit: Österreich war zu diesem Zeitpunkt noch ein besetztes Land und die politische Zukunft war ungewiss. Während die Bundesregierung diplomatisch agieren musste, nutzte der Gemeindebund die kommunale Ebene, um bereits frühzeitig an europäischen Prozessen teilzunehmen. Gemeinden boten Möglichkeiten zur internationalen Zusammenarbeit, die für Nationalstaaten noch verschlossen waren. Diese Vision ging insbesondere auf den seinerzeitigen Innsbrucker Bürgermeister Alois Lugger zurück, der mit seinem Weitblick und politischen Engagement den Weg für die europäische Vernetzung der österreichischen Kommunen ebnete.
Lugger war nicht nur Mitinitiator des österreichischen Beitritts zum RGE (1955 wurde daraus übrigens der Rat der Gemeinden und Regionen Europas, RGRE), sondern setzte sich auch aktiv für die Verankerung kommunaler Rechte auf europäischer Ebene ein. Unter seiner Führung war der Österreichische Gemeindebund 1953 maßgeblich an der Verabschiedung der Europäischen Charta der Gemeindefreiheiten beteiligt, die als erste europäische Grundsatzvereinbarung über kommunale Selbstverwaltung gilt.
Doch die europäische Vernetzung der Gemeinden stieß nicht überall auf Zustimmung. 1957 kam es in Straßburg zu einem historischen Wortgefecht zwischen Alois Lugger und Ernst Koref, dem damaligen Bürgermeister von Linz.
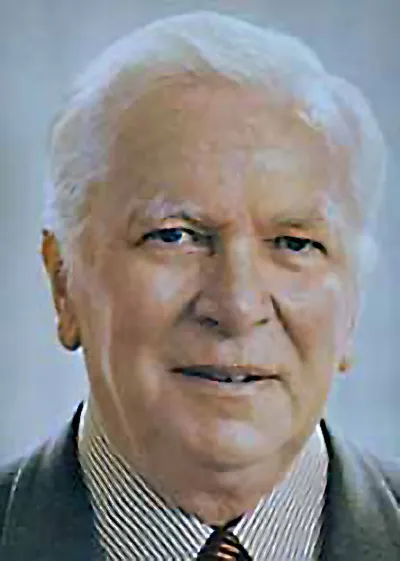
Die Diskussion entzündete sich an der Frage, ob die kommunale Zusammenarbeit auf europäischer Ebene überhaupt notwendig sei. Koref – ein erfahrener Politiker mit sozialdemokratischem Hintergrund – stellte die Bedeutung des RGRE infrage und argumentierte, dass ein internationaler Gemeindeverband überflüssig sei. Lugger hielt vehement dagegen und betonte, dass gerade die Zusammenarbeit der Kommunen Brücken zwischen den Nationen bauen könne – eine Erkenntnis, die sich später als richtungsweisend für die europäische Integration erwies.
Das leidenschaftliche Wortgefecht ging in die Geschichte der Konferenz ein. Während Koref und seine Anhänger zunächst Zweifel an der Relevanz des RGRE äußerten, setzte sich schließlich die Argumentation von Lugger und seinen Mitstreitern durch: Die Schaffung der „Konferenz der Gemeinden und Regionen beim Europarat“ wurde beschlossen und der RGRE erhielt dadurch eine formelle Anerkennung innerhalb der europäischen Institutionen.
Institutionelle Verankerung und nachhaltiger Einfluss
Die Beteiligung des Österreichischen Gemeindebundes an europäischen Initiativen blieb nicht auf symbolische Akte beschränkt. Vielmehr prägte der Gemeindebund aktiv die institutionelle Entwicklung der europäischen Kommunalpolitik:
- Erste politische Anerkennung: 1957 wurde mit der Konferenz der Gemeinden und Regionen Europas erstmals ein Gremium innerhalb des Europarats geschaffen, das sich direkt mit kommunalen Anliegen beschäftigte.
- Langfristiger Einfluss: Alois Lugger wurde in das Präsidium des RGRE gewählt und fungierte als Vizepräsident. Seine enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern trug dazu bei, dass kommunale Interessen zunehmend in europäische Entscheidungsprozesse einflossen.
Der Gemeindebund war nicht nur in den 1950er-Jahren aktiv, sondern blieb auch später eine treibende Kraft bei der Europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltung, die schließlich 1987 von Österreich ratifiziert wurde.
Starke Gemeinden für ein starkes Europa – aber auch mit Augenmaß
Während der Gemeindebund die europäische Idee weiterhin entschlossen unterstützt, steht er aktuellen Entwicklungen in der Regulierungspolitik der EU kritisch gegenüber. Europa darf nicht zum Bürokratie-Moloch werden, der Gemeinden mit praxisfernen Vorgaben überfordert.
Die Erfahrung zeigt, dass viele Verordnungen ohne Rücksicht auf lokale Gegebenheiten erlassen werden und kommunale Handlungsspielräume immer weiter einschränken. Gerade die Gemeinden, die täglich mit den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger arbeiten, müssen mehr Mitsprache erhalten.
Die zentrale Forderung des Gemeindebundes lautet daher: Europa muss wieder näher an die Gemeinden rücken. Gemeinsam mit seinen Partnern im RGRE setzt sich der Gemeindebund für eine Stärkung des Subsidiaritätsprinzips ein – also dafür, dass Entscheidungen möglichst auf der niedrigsten politischen Ebene getroffen werden. Das ist kein Rückzug aus der europäischen Zusammenarbeit, sondern ein Einsatz für ein effektiveres und bürgernäheres Europa. Überspitzt formuliert: Die europäische Idee ist zu wertvoll, um sie durch überzogene Bürokratie und Zentralismus zu gefährden.
Bei der Kritik nicht allein
Nicht nur der Österreichische Gemeindebund hat mehrfach auf die Herausforderungen hingewiesen, die durch überbordende Bürokratie auf EU-Ebene entstehen. Insbesondere wurde betont, dass solche bürokratischen Hürden die Effizienz und Handlungsfähigkeit der Gemeinden beeinträchtigen können. Prominente Beispiele für die Kritik an der EU-Bürokratie sind die Diskussionen um die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die Renaturierungsverordnung und das Gezerre um die EED III.
Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB), ein enger Partner der österreichischen Gemeindevertreter, hat darauf hingewiesen, dass übermäßige Bürokratie die kommunale Handlungsfähigkeit einschränkt. In einer Stellungnahme wurde beispielsweise betont, dass komplizierte Verfahren und umfangreiche Dokumentationspflichten die Effizienz der kommunalen Verwaltungen mindern und somit die Dienstleistungserbringung für die Bürger beeinträchtigen können.
Fazit
Zusammenfassend ergibt sich heute das Bild, dass sowohl der Österreichische Gemeindebund als auch andere kommunale Spitzenverbände in Europa die Notwendigkeit sehen, bürokratische Hürden auf EU-Ebene abzubauen, um die Effizienz und Handlungsfähigkeit der Gemeinden zu gewährleisten. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen notwendigen Regulierungen und praktikablen Umsetzungsanforderungen ist dabei entscheidend.
Charta der Gemeindefreiheiten
Die Europäische Charta der Gemeindefreiheiten wurde 1953 am 1. Europäischen Gemeindetag verabschiedet. Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, die politische, administrative und finanzielle Unabhängigkeit der Gemeinden zu gewährleisten.
Der Gemeindebund spielte eine aktive Rolle bei der Förderung und Umsetzung der Prinzipien dieser Charta.
In Österreich wurden die Grundsätze der Charta in der Bundes-Verfassungsgesetznovelle von 1962 verankert, was die Bedeutung der Gemeindefreiheit im österreichischen Staatsaufbau unterstreicht.
Die darauf aufbauende Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung wurde 1985 vom Europarat ausgearbeitet und trat 1988 in Kraft.










