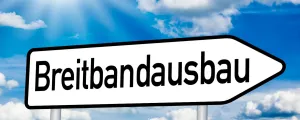Besonders Hallenbäder, die ganzjährig betrieben werden, erfordern erhebliche finanzielle Ressourcen für Personal, Energie und Instandhaltung.
© Andrei Armiagov - stock.adobe.com
Schwimmbäder sind keine kommunale Aufgabe
Steigende Betriebskosten und leere Gemeindekassen stellen den Weiterbetrieb von Schwimmbädern in Österreich auf den Prüfstand. Ist deren Erhalt überhaupt noch Aufgabe der Kommunen? Und wenn nicht, welche Alternativen bieten sich an?
Die finanzielle Lage österreichischer Gemeinden hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschärft. Steigende Betriebskosten, wachsender Investitionsbedarf und stagnierende Einnahmen zwingen Kommunen dazu, ihre Ausgaben kritisch zu hinterfragen. Während Pflichtaufgaben wie die Wasserversorgung, Abfallentsorgung und der Betrieb von Bildungseinrichtungen Priorität genießen, geraten freiwillige Leistungen zunehmend unter Druck. Schwimmbäder – ob Hallen- oder Freibäder – gehören zu den teuersten Einrichtungen im kommunalen Portfolio und stehen daher besonders im Fokus. Vor dem Hintergrund knapper Budgets stellt sich die grundlegende Frage, ob der Betrieb solcher Einrichtungen weiterhin in die Verantwortung der Gemeinden fällt.
In vielen Kommunen ist das Schwimmbad eine fest etablierte Institution, oft über Jahrzehnte hinweg gewachsen und von den Bürgern geschätzt. Doch die Betriebskosten sind enorm.
Besonders Hallenbäder, die ganzjährig betrieben werden, erfordern erhebliche finanzielle Ressourcen für Personal, Energie und Instandhaltung. Selbst gut besuchte Einrichtungen arbeiten meist defizitär, da die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und anderen Quellen kaum die hohen laufenden Kosten decken. Diese finanzielle Last überfordert zunehmend vor allem kleinere Gemeinden, die ohnehin schon an ihre Grenzen stoßen.
Daseinsvorsorge oder freiwillige Leistung?
Um zu beurteilen, ob Schwimmbäder eine kommunale Aufgabe bleiben sollten, ist zunächst eine klare Definition der Daseinsvorsorge notwendig. Dieser Begriff umfasst Dienstleistungen, die für das Gemeinwohl essenziell sind, wie die Versorgung mit Trinkwasser, die Bereitstellung von Energie oder die Gewährleistung von Bildung und öffentlicher Sicherheit.
Schwimmbäder fallen hingegen nicht in diese Kategorie. Sie sind weder gesetzlich vorgeschrieben noch zwingend notwendig, um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu sichern. Dennoch werden sie oft als unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen Infrastruktur angesehen, da sie Freizeitmöglichkeiten bieten, die Gesundheit fördern und eine zentrale Rolle beim Erlernen des Schwimmens spielen.
Schwimmenlernen wird dabei häufig als Argument für den Erhalt kommunaler Bäder ins Feld geführt. Und dieses Argument ist stark. Besonders in ländlichen Regionen, wo Flüsse und Seen oft schwer zugänglich sind, spielen Schwimmbäder eine zentrale Rolle.
Eine Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) weist alarmierende Zahlen aus: Etwa 230.000 Kinder und Jugendliche in Österreich können nicht oder nur unsicher schwimmen. Schwimmunterricht ist daher von großer Bedeutung, doch die Verantwortung dafür liegt primär bei den Schulen. Der Bildungsbereich, nicht die Kommunen, sollte dafür die notwendigen Ressourcen bereitstellen. Laut der KFV-Studie haben rund ein Sechstel der Kinder ihre Schwimmkenntnisse ausschließlich im Schulunterricht erworben. Das verdeutlicht, dass Schulen der zentrale Ort für die Schwimmausbildung sein müssen, unabhängig davon, ob Schwimmbäder kommunal oder anders organisiert sind.
Die Kostenfrage: Warum Gemeinden überfordert sind
Ein Blick auf die finanzielle Realität zeigt, dass der Betrieb von Schwimmbädern die Möglichkeiten vieler Gemeinden übersteigt. Selbst mittlere und größere Städte kämpfen mit den hohen Betriebskosten, während kleinere Kommunen oft gezwungen sind, ihre Bäder zu schließen oder nach externen Lösungen zu suchen. Der Sanierungsbedarf vieler älterer Anlagen verschärft die Problematik zusätzlich. In vielen Fällen stehen Gemeinden vor der Wahl, entweder erhebliche Investitionen zu tätigen oder das Schwimmbad vollständig aufzugeben.
Wer könnte Schwimmbäder betreiben, wenn nicht die Gemeinden?
Wenn Schwimmbäder keine kommunale Aufgabe sind, stellt sich die Frage, wer ihre Trägerschaft übernehmen könnte. Zwei Modelle haben sich in der Praxis als besonders erfolgversprechend erwiesen: regionale Kooperationen und überregionale Trägerschaften.
Das Walgaubad in Vorarlberg zeigt, wie interkommunale Zusammenarbeit zum Erfolg führen kann. Durch den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden konnten die finanziellen Lasten auf mehrere Schultern verteilt werden. Insgesamt 14 Gemeinden arbeiten zusammen, um die Kosten des Walgaubads zu tragen. Ein regionaler Finanzierungsschlüssel, der Faktoren wie Einwohnerzahl, Finanzkraft und Entfernung berücksichtigt, sorgt für eine gerechte Verteilung der Ausgaben. Damit wurde nicht nur den Betrieb gesichert, sondern auch der regionale Zusammenhalt gestärkt.
Ein ähnliches Beispiel ist das Hallenbad im niederösterreichischen Gänserndorf, das ebenfalls von mehreren Gemeinden gemeinsam betrieben wird.
Eine andere Möglichkeit ist die Übernahme durch Bundesländer, wie im Fall von Pinkafeld. Das dortige Hallenbad wurde durch das Land Burgenland übernommen, da die Gemeinde die finanziellen Lasten nicht mehr tragen konnte. Dieses Modell entlastet die Gemeinde und stellt sicher, dass die Einrichtung weiter genutzt werden kann. Solche Lösungen erfordern jedoch klare vertragliche Regelungen und finanzielle Unterstützung, um sicherzustellen, dass die Einrichtungen langfristig betrieben werden können. Darüber hinaus könnten auch private Betreiber eine Rolle spielen, insbesondere in touristisch attraktiven Regionen.

Tourismus als ergänzende Finanzierungsquelle
In touristischen Regionen bieten Schwimmbäder zusätzliches Potenzial. Das Nibelungenbad in Marbach an der Donau zeigt, wie eine gezielte Ausrichtung auf Touristen Einnahmen generieren kann. Durch die Generalsanierung wurde das Bad zu einem regionalen Anziehungspunkt, der nicht nur den Einheimischen, sondern auch Gästen zugutekommt. Diese Strategie hat jedoch ihre Grenzen, da der Erfolg stark vom Standort und der vorhandenen Infrastruktur abhängt. Für Gemeinden ohne touristisches Potenzial ist dieser Ansatz daher kaum umsetzbar.
Fluss- und Naturbäder: Eine günstige Alternative
Eine interessante Option für Gemeinden mit begrenztem Budget sind Fluss- und Naturbäder. Diese Anlagen benötigen weniger Infrastruktur und sind im Unterhalt deutlich günstiger. Das revitalisierte Flussbad in Ybbs zeigt, dass solche Alternativen sowohl für Einheimische als auch für Touristen attraktiv sein können. Allerdings sind sie saisonal eingeschränkt und eignen sich daher nicht als Ersatz für Hallenbäder, die ganzjährig genutzt werden können.
Eine systemische Lösung: Der aufgabenorientierte Finanzausgleich
Eine langfristige und gerechte Lösung könnte die Einbindung von Schwimmbädern in den aufgabenorientierten Finanzausgleich sein. Wenn Schwimmbäder als Teil der regionalen Infrastruktur anerkannt würden, könnten sie gezielt gefördert werden. Dies würde nicht nur die finanzielle Belastung der Gemeinden verringern, sondern auch sicherstellen, dass Schwimmbäder flächendeckend erhalten bleiben. Eine solche Reform könnte Anreize für interkommunale Zusammenarbeit schaffen und die langfristige Planung erleichtern.
Die Zukunft der Schwimmbäder in Österreich
Schwimmbäder sind wertvolle Einrichtungen, die Gesundheit, Sicherheit und Freizeit fördern. Doch sie sind keine kommunale Pflichtaufgabe. Angesichts der finanziellen Belastungen und begrenzten Budgets müssen neue Lösungen gefunden werden.
Regionale Kooperationen und überregionale Trägerschaften bieten praktikable Alternativen, während eine gesonderte Berücksichtigung durch einen bedarfsorientierten Finanzausgleich Schwimmbäder langfristig sichern könnte.
Ohne solche Reformen droht nicht nur ein flächendeckendes „Bädersterben“, das vor allem Kinder und Nichtschwimmer trifft, sondern es ist vielerorts voll im Gange und weit fortgeschritten. Die Zeit für einen Kurswechsel ist daher schon überreif – im Interesse der Gemeinden, ihrer Bürger und der nächsten Generationen.
Faktencheck - schwer bis unmöglich
Die Anzahl der Hallen- und Freibäder in Österreich hat in den letzten Jahren abgenommen. Laut einem Bericht im „Standard“ von 2021 gab es 2018 insgesamt 379 Freibäder, während diese Zahl bis 2020 auf 331 sank. Die Anzahl reiner Hallenbäder verringerte sich im selben Zeitraum von 111 auf 94.
Die genaue Anzahl von Fluss- und Strandbädern in Österreich ist schwer zu bestimmen, da diese oft nicht zentral erfasst werden. Es gibt jedoch zahlreiche Naturbadeplätze entlang von Flüssen und Seen, die von Gemeinden oder privaten Betreibern unterhalten werden. Die Plattform schwimmbadcheck.at listet beispielsweise über 900 Bäder und Badeseen in Österreich auf, darunter auch Fluss- und Strandbäder.
Eine detaillierte Auflistung aller Fluss- und Strandbäder ist aufgrund der Vielzahl und der unterschiedlichen Zuständigkeiten nicht möglich.