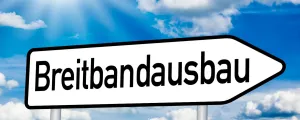Die Priorisierung der Ausbaugebiete basiert letztlich auf wirtschaftlichen Kriterien, der Verfügbarkeit alternativer Anschlüsse wie Eutelsat und der prognostizierten Nutzung. Laut einem aktuellen Bericht nutzen aktuell nur rund 22 Prozent der Haushalte die verfügbaren Glasfaseranschlüsse.
© ThomBal - stock.adobe.com
Infrastruktur
Glasfaser in Österreich - schnelles Netz, langsamer Ausbau
Österreich wollte beim Glasfaserausbau europaweit ganz vorne mitspielen, doch aktuell belegen wir im EU-Vergleich den letzten Platz. Zwar wurden große Förderprogramme ins Leben gerufen, doch der Wunsch nach flächendeckendem Zugang zu schnellem Internet bleibt vielerorts unerfüllt.
Glasfaser bietet nahezu unbegrenzte Kapazitäten sowie stabile Bandbreiten und ist unabhängig vom Nutzungsverhalten anderer, weshalb langfristig kein Weg daran vorbeiführt.
Versprochen & verschoben – Warum viele Gemeinden leer ausgehen
Kommunen mit flächendeckendem Glasfaseranschluss sind als Wohn- und Wirtschaftsstandorte deutlich attraktiver, da sie Homeoffice ermöglichen und moderne Kommunikation fördern. Um aber diese Vorteile nutzen zu können, müssen Gemeinden sich durch ein kompliziertes Förderdickicht kämpfen, um Glasfaserprojekte überhaupt finanzieren zu können. Fördergelder wie jene aus der Initiative Breitband Austria 2030 sind theoretisch vorhanden – praktisch aber komplex zu beantragen.
Doch neue Technologien wie Starlink und 5G bieten attraktive Alternativen. Starlink, Elon Musks Satelliteninternet-Projekt, versorgt nun auch österreichische Haushalte mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s, ganz ohne Bagger und Bürokratie. Auch Europa entwickelt Alternativen zum amerikanischen Satelliten und arbeitet aktuell am sogenannten Eutelsat. 5G wiederum bringt gigabitfähiges mobiles Internet in Ballungsräume.
Aufgrund der Vielzahl an Alternativen und der komplizierten Förderlogik bleiben viele Kommunen nun auf halb fertigen Projekten sitzen. Teilweise wurden versprochene Ausbauprojekte nun von Unternehmen um mehrere Jahre verschoben.
Für die betroffenen Gemeinden bedeutet der fehlende Glasfaseranschluss nicht nur einen Rückschlag bei der Digitalisierung, sondern auch konkrete wirtschaftliche und soziale Nachteile. Investitionen in Vorleistungen verlieren ihre Wirksamkeit, Bauland bleibt ungenutzt, Unternehmen überlegen, ihre Standorte anders zu wählen. Zudem leidet das Vertrauen in öffentliche Zusagen, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik.
Steigende Kosten & sinkende Nachfrage – Unternehmen unter Druck
Auch die Unternehmen befinden sich in einer schwierigen Lage und ringen damit, ihre Zusagen einzuhalten. Branchenvertreter begründen das damit, dass die hohen Investitionskosten ein zentrales Hindernis für den Glasfaserausbau bleiben.
Die wirtschaftliche Lage hat sich in den letzten Jahren verschlechtert, die Material- und Baukosten sind deutlich gestiegen. Ursprünglich geplante Projekte müssen daher neu bewertet und teilweise verschoben werden.
Dazu kommt, dass die Nachfrage der privaten Haushalte (die sogenannte Take-Rate) hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Zurückhaltung der Bevölkerung bei Glasfaseranschlüssen wirkt sich direkt auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen aus.
Darüber hinaus führt die Verteilung öffentlicher Fördermittel zu Verzögerungen. Ein wesentlicher Grund liegt in der Priorisierung von Fördergebieten: Der Staat hat mehrere hundert Millionen Euro bereitgestellt, um vor allem ländliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte zu versorgen. Diese Förderprojekte unterliegen Fristen und werden daher bevorzugt umgesetzt.
Die Priorisierung der Ausbaugebiete basiert letztlich auf wirtschaftlichen Kriterien, der Verfügbarkeit alternativer Anschlüsse wie Eutelsat und der prognostizierten Nutzung. Laut einem aktuellen Bericht nutzen aktuell nur rund 22 Prozent der Haushalte die verfügbaren Glasfaseranschlüsse.
Wie es weitergeht: Zusammen statt Stillstand
Trotz dieser Hürden sind Gemeinden nicht machtlos, im Gegenteil: So können zum Beispiel bei den Ausbaukosten Synergien genutzt werden.
Eine gezielte Abstimmung von Bauvorhaben, etwa die gemeinsame Umsetzung von Kanalbauarbeiten und Glasfaserverlegung, kann Kosten senken. Voraussetzung dafür ist eine frühzeitige Kommunikation mit Infrastrukturanbietern wie A1, da beispielsweise die Bauprogramme für 2025 bereits finalisiert sind. Ein geplanter Tiefbauatlas soll künftig zeigen, wann und wo in welcher Gemeinde gegraben wird, um die Koordination noch besser zu ermöglichen.
Auch alternative Verlegemethoden können Abhilfe schaffen: In Streusiedlungen etwa bieten Luftkabel über Holzmasten eine Übergangslösung, bis eine spätere Verlegung in die Erde, etwa im Rahmen von Straßensanierungen, möglich ist. Eines ist klar: Die Zusammenarbeit von Unternehmen und Gemeinden ist besonders wichtig.
Trotz aller Herausforderungen kann also eine Lösung gefunden werden, aber nur durch konstruktive Zusammenarbeit aller Parteien. Denn Glasfaser bleibt auf lange Sicht unersetzlich. Es ist stabil und zukunftssicher. Satelliteninternet und Mobilfunk sind sinnvolle Ergänzungen, aber kein Ersatz für ein robustes Netz.
Wenn Österreich digital souverän bleiben will, braucht es die Bereitschaft, gemeinsam im Sinne des öffentlichen Interesses eine Lösung zu finden. Denn Starlink kommt aus dem All, aber Glasfaser kommt aus der Gemeinde.
Der „Tiefbauatlas“
Vision: Ein zentraler österreichweiter und sektorübergreifender „Tiefbauatlas“, der akkordierte ressourcenschonende und kosteneffiziente Tiefbauaktivitäten ermöglicht.
Maßnahmen: Umsetzung eines sektorübergreifenden Tiefbau-Ausbauplans durch die Zusammenführung und Zurverfügungstellung bestehender Datenquellen für geplante öffentliche und private Tiefbauprojekte jeglicher Art.
Diese Maßnahmen bewirken: Der Breitbandausbau in Österreich wird sowohl beschleunigt als auch günstiger und nachhaltiger.
Quelle: www.digitaloffensive.at