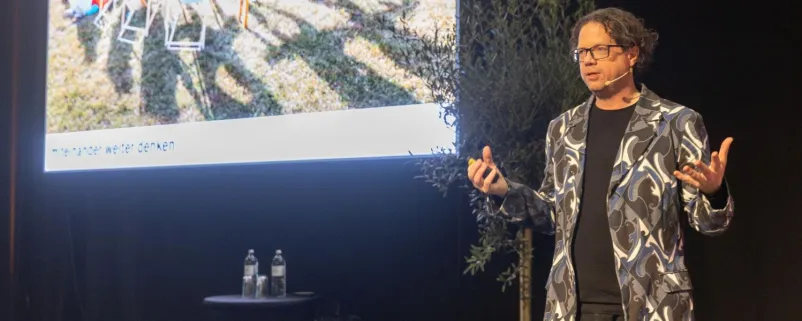
Roland Gruber: „Wir bekommen mehr – und bauen weniger. Das ist der Schlüssel.“
© Jürg Christandl
Bauen
Ortskernentwicklung mit Herz, Hirn und Bauch
„Zukunftsfreude ist das Um und Auf, um gut gestalten zu können“, sagte Roland Gruber vom Architektbüro nonconform, der auch Vizebürgermeister der Kärntner Gemeinde Moosburg ist. In seiner Keynote beim Kommunalwirtschaftsforum.
Doch diese Freude sei vielen Menschen derzeit abhandengekommen. Gruber zeichnete ein Bild der gesellschaftlichen Erschöpfung: „Wir werden täglich mit negativen Nachrichten konfrontiert. Viele Menschen haben das Vertrauen in die Zukunft verloren.“ Dabei sei es genau dieses Vertrauen, das wir brauchen, um neue Wege zu gehen – besonders in der Orts- und Stadtentwicklung.
Gruber beschrieb ein Spannungsfeld, das tief in unserer Gesellschaft verankert ist – und auch in uns selbst: „In der Brust vieler Menschen gibt es zwei Seelen. Die eine weiß, dass es Veränderungen braucht. Die andere sehnt sich nach Beständigkeit.“ Er nennt sie die „Helden des Vorwärts“ und die „Helden des Rückwärts“. Veränderung werde zwar gefordert, aber auch gefürchtet – ein Dilemma, das vielen Kommunen zu schaffen mache.
Doch genau hier setzt seine Arbeit an: bei der aktiven Beteiligung der Bevölkerung und dem gemeinschaftlichen Entwickeln von Lösungen. Gruber betonte, wie essenziell es sei, alle mitzunehmen: „Wir müssen dorthin, wo der Schuh drückt. Vor Ort. Nicht im stillen Kämmerlein planen, sondern mitten im Leben.“
Bauchentscheidungen am Esstisch
Dabei verlässt der Architekt bewusst die gewohnten Pfade der Stadtplanung. Statt auf klassische Beteiligungsformate zu setzen, bringt er die Menschen bei Mahlzeiten zusammen, im informellen Gespräch, beim gemeinsamen Tun: „Die wichtigsten Entscheidungen werden nicht im Konferenzraum getroffen, sondern beim guten Essen.“ Planung müsse nicht nur mit dem Kopf und dem Reißbrett geschehen – sondern auch mit dem Bauch.
Gruber plädiert für einen Perspektivwechsel: „Wir brauchen in der Raumplanung die harten Fakten – aber auch die Softfacts. Das Messen und Berechnen ist wichtig, aber genauso das Diskutieren und das kultivierte Streiten.“
Impulse statt Masterpläne
Anstatt groß angelegte Masterpläne zu entwerfen, verfolgt nonconform einen anderen Ansatz: das sogenannte „Domino-Prinzip“. „Wir suchen immer das wirksamste Projekt, das sofort eine Dynamik auslöst. Nicht ein Puzzle, das irgendwann jemand fertigstellen soll, sondern ein erster Dominostein.“ Die Umsetzung beginne nicht nach dem Plan, sondern während des Prozesses.
Ein solcher erster Stein könne auch klein sein – wie das „Klima-Fitness-Center“ in Moosburg, wo Gruber Vizebürgermeister ist. In einem leerstehenden Friseursalon wurden Fitnessgeräte aufgestellt, die mit Informationen zur CO2-Einsparung kombiniert wurden. „Wir wollten CO2-Einsparung greifbar machen – in Kilo statt Tonnen.“ Wer fünf Minuten kürzer duscht, spart jährlich rund 1800 Kilogramm CO2, erklärt Gruber. „Solche kleinen, verständlichen Botschaften bleiben hängen.“
Mehr durch weniger
Ein zentrales Leitmotiv Grubers ist das Prinzip „mehr durch weniger“: mehr Lebensqualität, mehr soziale Interaktion, mehr Nutzung – bei gleichzeitig weniger gebautem Raum, weniger CO2-Ausstoß, weniger Ressourcenverbrauch.
„Wir nennen das Baureduktionsplanung. Mit Hirnschmalz entwickeln wir Lösungen, bei denen weniger gebaut werden muss – und trotzdem mehr erreicht wird.“
Ein Beispiel ist die Umnutzung einer alten Kläranlage in Bayern zur „Air-Kläranlage“ – einem Raum für Jung und Alt. In einer anderen bayrischen Gemeinde wurde aus einem leerstehenden Hotel mit Gasthaus ein multifunktionales Zentrum für Coworking, mit einem Musikproberaum, einem Veranstaltungssaal und reaktivierter Gastronomie.
Vom Leerstand zum Lernraum
Auch Schulumbauten gehören zum Repertoire: In Leoben wurden drei veraltete Schulen in einem denkmalgeschützten Gebäude zusammengelegt – ohne großen Neubau, dafür mit kluger Raumorganisation. Wände wurden entfernt, Gänge zu Lernzonen umgewidmet, die Schule zum offenen Lernraum transformiert. „Wir bauen keine Klassenräume – wir schaffen Lernlandschaften.“ Ergänzt wurde das Ganze lediglich durch eine Mensa und eine Bibliothek im Hof.
Ein weiteres Beispiel aus Kärnten: „Das Geld bleibt in der Mitte!“ Eine Sparkasse hatte beschlossen, ihre Filialen aus dem Zentrum an den Stadtrand zu verlegen. „Eine katastrophale Entscheidung“, so Gruber. Doch durch einen intensiven Beteiligungsprozess wurde die Entscheidung revidiert. Statt Neubau am Stadtrand wird nun das historische Gebäude im Zentrum revitalisiert. Unten entsteht ein Kaffeehaus, oben eine Skybar, dazwischen bleibt Raum für Bankgeschäfte – in neuer Form.
Aufwertung ohne Neubau
Dass Aufwertung nicht immer bedeutet, neue Wände zu errichten, zeigt auch das Projekt „Vor dem Haus wird’s wohnlich“ in Saalfeld (Thüringen). In einem Wohnviertel mit hohem Migrationsanteil stellte sich heraus, dass die eigentlichen Probleme nicht in den Wohnungen lagen – sondern draußen. „Es fehlten Orte der Begegnung.“ Entstanden ist ein Werkhaus, das gemeinsames Kochen, Feiern, Arbeiten ermöglicht. Gebaut wurde es mit wiederverwerteten Materialien und mit Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner selbst.
„So entsteht Identifikation – nicht nur mit dem Gebäude, sondern mit dem Ort.“ Die Baustelle wurde zum sozialen Raum, zum Ort der Beteiligung. Der Bauleiter fungierte als Moderator zwischen Handwerk, Bewohnern und Verwaltung.
Die Stadt ist schon da
Ein besonders eindrucksvolles Projekt spielt sich in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) ab: Mitten in der Stadt liegt ein 38 Hektar großes Gelände einer stillgelegten Papierfabrik – eine Stadt in der Stadt. Viele hätten das Areal am liebsten abgerissen. Doch Gruber und sein Team entschieden sich für das Gegenteil: „Im Bestand ist so viel CO2 gebunden. Abreißen ist keine Lösung.“
Stattdessen öffneten sie das Gelände, luden Bürgerinnen und Bürger ein, Studierende, lokale Initiativen. Erste Räume wurden bespielt, Masterarbeiten geschrieben, erste Nutzungen etabliert. „Die neue Stadt ist eigentlich schon da“, sagt Gruber. Jetzt gehe es darum, Schritt für Schritt zu besiedeln – mit einer langfristigen Strategie und einer lokalen Kümmerer-Struktur.










