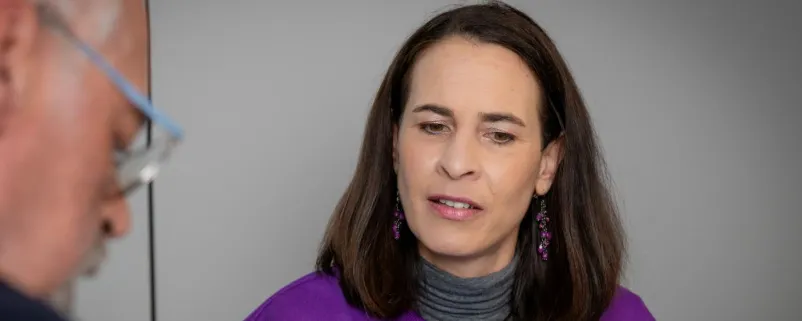
„Wir sind längst kein Umweltmusterschüler mehr und importieren mehr als 64 % (fossile) Energie. Wir müssen daher dekarbonisieren – und wir hätten das Potenzial dafür in Österreich.“ Lisa Csenar im Gespräch mit KOMMUNAL-Chefredakteur Hans Braun.
Warum Bürgermeister mehr Unterstützung bei der Energiewende brauchen
Bürgerbeteiligung, finanzielle Entschädigung für Gemeinden und schnellere Genehmigungen: Diese Faktoren könnten den Windkraft-Ausbau in Österreich beschleunigen. Doch derzeit blockieren bürokratische Hürden viele Projekte. Lisa Csenar, Geschäftsführerin der Verbund Green Power Österreich GmbH, im Gespräch mit Hans Braun von KOMMUNAL.
Frau Csenar, Sie haben bei der Großinfrastruktur-Projekte Konferenz gemeint, dass die Rahmenbedingungen für Windkraftprojekte im Ausland günstiger sind als in Österreich. Welche konkreten politischen oder regulatorischen Anwendungen wären aus Ihrer Sicht notwendig, um den Ausbau hierzulande attraktiver zu gestalten?
Lisa Csenar: Ja. Ich finde, es braucht deutlich mehr Bekenntnis vom Bund und der Landespolitik zu unseren Ausbauzielen. Das ist das Wichtigste. Es braucht ein klares Signal, dass es jetzt in diese Richtung geht. In Österreich ist es mehr ein Zickzack-Kurs, was es sehr schwierig macht. Beispielsweise haben dann unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister keinen Rückhalt wenn in ihren Gemeinden Energiewende Projekte geplant sind.
Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass die Kommunalpolitikern Rückhalt von der Landes- oder Bundespolitik bekommen. Die Kommunalpolitiker haben es sehr schwer, die Dinge erklären zu müssen.
Der Bund müsste erklären, warum wir weitere Wind- und PV-Projekte brauchen, obwohl es schon viele Wasserkraftwerke in Österreich gibt. Wir sind längst kein Umweltmusterschüler mehr und importieren mehr als 64 Prozent (fossile) Energie. Wir müssen daher Dekarbonisieren, und wir hätten das Potential dafür in Österreich. Ein klares Commitment von „oben“ würde es den Kommunalpolitiker viel leichter in der Argumentation machen.
Das heißt, der Bund sollte vor-formulieren, damit in der Argumentation alles einheitlich ist?
Ja, wir schaffen das nur gemeinsam. Es sollte auch nicht sein, dass jedes Bundesland was anderes macht und anders argumentiert. Der Ausbau, der vor uns liegt, ist so ein massiver Ausbau, das kann man nur gemeinsam schaffen.
Gibt es diese Ausbau-Ziele irgendwo zentral formuliert? Oder den Ausbau-Plan?
Es gibt verschiedene Ziel-Formulierungen. Einerseits die Ziele aus dem „Energie Ausbau Gesetz“(EAG), dann die Ziele des österreichischen Netzinfrastrukturplans (OeNIP). Und dann gibt es noch den Nationale Energie- und Klimaplan (NEKP) den man mit einiger Verzögerung voriges Jahr im Juli (verspätet, Anm. d. Red.) nach Brüssel geschickt hat. Die Zielvorgaben in EAG, OeNIP und NEKP sind nicht einheitlich
Die Ziele müssten konsolidiert werden, um klar festzulegen, was jetzt wirklich das Ziel ist.
Dann sollten die Ziele auf alle Bundesländer heruntergebrochen werden. Wenn man sich die Klima- und Energieziele der einzelnen Bundesländer anschaut, finden sich manchmal EAG Ziele, aber nicht konsistent. Es gibt beispielsweise Bundesländer, wo Windkraft gar nicht vorkommt, obwohl es Potenzial gäbe
Das haben Sie bei der Konferenz ja gesagt, dass das regional schwierig ist. Sie setzen stark auf Bürgerbeteiligung mit dem Bürger Stromtarif und das Klima Spar Modell. Welche Erfahrungen haben Sie denn da genau gemacht?
Damit haben wir immer sehr gute Erfahrungen gemacht, weil einerseits die Gemeinde was davon haben soll, aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Wenn man nur eine Art “Mehrwert-Paket“ für die Gemeinde anbietet, sagt der einzelne Bürger sehr oft, „und was hab‘ ich davon?“.
Indirekt haben die Bürgerinnen und Bürger etwas davon, weil eine gute und moderne Infrastruktur der Gemeinde sich auch positiv auf sie auswirkt. Das ist für uns klar, aber unmittelbar merkt es die Bevölkerung nicht so.
Darum haben wir uns einfach was einfallen lassen, damit sich die Menschen an der Energiewende beteiligen können. Wir haben dazu ein Modell entwickelt, das ähnlich einem Bausparvertrag funktioniert. Man kann sich mit einem gewissen Betrag beteiligen und hat eine fixe Verzinsung für die nächsten fünf Jahre.
Und das zweite Modell ist, was auch immer wieder in Umfragen herausgekommen ist: für Bürgerinnen und Bürger ist ein stabiler Strompreis wichtiger als ein kurzfristiger niedriger Strompreis. Also bieten wir in den Standortgemeinden, wo wir Projekte machen, für 20 Jahre einen stabilen Strompreis an.
Wir erleben im Moment einen Generationenwechsel in den Gemeindeführungen. Ihrer Erfahrung nach: sind die jüngeren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eher bereit sind, etwas in der Richtung Energiewende zu unternehmen?
Das würde ich nicht sagen, dass das vom Alter abhängig ist. Meine Erfahrung bestätigt das jedenfalls nicht. Es gibt ältere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sehr aktiv für die Energiewende sind, aber auch jüngere, die dagegen sind. Da gibt es keinen Zusammenhang aus meiner Sicht.
Die gesetzlichen Vorgaben in Österreich erschweren eine Ansiedlung von Windrädern, wie sie in der Konferenz Mitte Februar meinten. Welche Vorgaben haben sie da genau gemeint?
Wir müssen für unsere Projekte, zum Beispiel für Windparks, eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen. Aber schon davor braucht es in manchen Bundesländern eine Umwidmung, in manchen nicht. Das ist schon der erste Punkt, warum Projekte so lang dauern.
Bei Windprojekten müssen vor der Umweltverträglichkeitsprüfung zwei Jahre lang ornithologische Untersuchungen gemacht werden. Auch ein Grund, warum das so lange dauert.
Dazu kommt, dass die Behörden zum Teil sehr unterbesetzt – es bräuchte viel mehr Sachverständige, damit das schneller gehen kann.
Auch im Bundesverwaltungsgericht. Die haben einfach eine wahnsinnige Fülle an Themen, die die Behörden behandeln müssen. Und wir landen leider sehr oft mit unseren Projekten, weil irgendwer Einspruch erhebt, beim Bundesverwaltungsgericht. Das ist auch so ein Grund, warum wir so lange Verfahrensdauer haben.
Dann haben wir oft das Thema, dass Gemeinden eine Art „Entschädigung“ fordern, wenn wir mit einem Projekt kommen.– was schwierig ist. Wir haben lange nach einem Modell gesucht, wie wir Gemeinden irgendwie kompensieren können. Im Burgenland beispielsweise gibt es ein Gesetz dafür. Im Raumordnungsgesetz im Burgenland ist reglementiert, dass ich pro Megawatt Windkraft und pro Hektar Photovoltaik einen gewissen Betrag fifty fifty an Land und Gemeinde zahlen muss. Unser Vorschlag wäre eine gesetzliche Regelung für ganz Österreich mit fixen Zahlungen pro Megawatt Wind oder pro ha für PV, allerdings sollten die Beträge ausschließlich an die Standortgemeinden gehen.
Man hat auch bei der Konferenz bei dem Gemeindevertreter aus Gaal (in der Steiermark, Anm. d. Red.) gesehen, dass die beim Land immer wieder um juristische Unterstützung zu dem Thema angesucht haben, aber keine Unterstützung erhalten haben. Darum wäre eine gesetzliche Regelung so elegant. Das Thema betrifft ja nicht nur uns als Energieerzeuger, sondern beispielsweise auch die Netzbetreiber oder andere Infrastrukturbetreiber. Wir haben alle dasselbe Thema.
Meines Wissens steht im Regierungsprogramm nichts dazu. Erkennen Sie Tendenzen, dass man so was umsetzt?
Es steht im Regierungsprogramm zwar was zum ElWOG (Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz) und dass das „Erneuerbaren-Energien-Beschleunigungsgesetz“ wieder angegriffen wird, was ist natürlich sehr positiv. Aber darüber hinaus habe ich auch noch nichts gesehen.
Man muss auch dazu sagen, das Gesetz gibt’s ja nicht nur im Burgenland. Es gibt in Deutschland und in Rumänien ein ähnliches Gesetz, es ist jetzt nichts Exotisches. Wir hätten auch schon einen Vorschlag erarbeitet, aber der ist leider noch nicht weitergekommen.
Zum Projekt in der steirischen Gemeinde Gaal haben Sie gesagt, dass Sie dort viele Learnings gemacht haben, also aus Fehlern gelernt haben. Wo hat es denn dort angefangen, schief zu laufen? Schon mit der ausgebliebenen juristischen Hilfe für die Gemeinde?
Das war sicher eines der großen Themen, dass keine Unterstützung von der Landesseite kam. Die Gemeinde hat da immer wieder angefragt und da kam nie eine Rückmeldung.
Was wir gemacht haben, aber nicht in der notwendigen Detailtiefe, war die Stakeholder-Analyse. Das war eines der wesentlichen Learnings. Wir haben das zwar begonnen haben, aber nicht in der Intensität, wie wir es jetzt machen und auch künftig machen werden. Seitdem beschäftigen wir uns viel mehr damit.
Damals war auch unser Stromtarif-Modell noch nicht fertig. Ein weiteres Learning war also, dass man die Modelle fertig haben muss – und sie müssen einfach sein. Unser erstes Modell war ähnlich einer Energiegemeinschaft, aber das haben wir nicht rübergebracht und die Bürger:innen haben es nicht verstanden. Modelle müssen so einfach sein, damit es wirklich jeder versteht.
Was wir auch gelernt haben, dass wir vorab eine Vertrauensebene mit dem Bürgermeister aufbauen. Da ist aber auch die Frage, wann geht man mit einem Projekt zum Bürgermeister? In einem frühen Stadium schwierig, denn auf Rückfragen wissen wir in einem frühen Stadium oft noch nicht, ob es wirklich was wird. In der Steiermark ist es uns so gegangen, dass ein Teil eines Projekts auf einer Bergkuppe war, die zu wenig Wind hatte. Wir haben dort zwei Windmess-Masten aufgestellt, und bei einem hat sich gezeigt, da geht nix. Daher gehen wir eher später als früher mit Infos an die Leute, weil wir sie sonst ja für nichts „narrisch“ machen.
Aber in der Sekunde, wo sie so einen Windmessmasten aufstellenn, sieht man ja, dass da was im Busch ist. Spätestens zu dem Zeitpunkt müsste eigentlich zumindestens ein Plan kommuniziert und die Leute abgeholt werden.
So machen wir das auch. Es geht ja auch gar nicht anders, denn für einen Windmessmast braucht man ja auch eine Baubewilligung mit Bauverhandlungen und allem. Wichtig ist die Information, dass, selbst wenn der Windmess-Mast steht, es keine Garantie ist, dass dort ein Windrad hinkommt. So ein Projekt kann relativ rasch wieder vorbei sein.
In Tirol ist uns beispielsweise passiert, dass ein Steinadler-Pärchen seinen Horst mitten ins Projektgebiet gesetzt hat. Dann war die Sache auch schon wieder vorbei.
Ich habe im Internet ein bisschen gegoogelt, da gibt es hunderte Seiten mit den verschiedensten Mythen zur Windkraft. Und überall steht, Windräder killen Vögel. Versuchen Sie dagegen zu argumentieren, dass das eben ein Mythos ist?
Wir probieren immer wieder, diesbezüglich aufzuklären. Nur, wenn du mit einer Studie kommst, findet irgendwer im Internet eine Studie, die genau das Gegenteil besagt.
Aber aus unserer Erfahrung, wir haben ja 116-MW-Windkraftanlagen in Österreich und über 700 MW im Ausland in Betrieb. Da sehen wir ja, was passiert. Wir haben sowieso ein verpflichtendes Monitoring im Betrieb, da würde man sehen, wenn so viel Vogelschlag wäre. Das Monitoring muss von einem Externen betreut werden. Das ist das eine.
Zweitens wird im Vorfeld schon zwei Jahre untersucht, wenn da eine „kritische Art“ wäre, wo beispielsweise der Horst quasi mitten im Gebiet ist, dann gibt es sowieso keine Genehmigung. Es gibt verschiedene Arten wie den Wespenbussard oder den Sakerfalken - wenn so eine Art im Projektgebiet vorhanden ist, gibt es keine Genehmigung.
Zweitens schaffen wir bei unseren Projekten auch viele Ausgleichsmaßnahmen oder Attraktivitätsflächen. Ausgleichsmaßnahmenwäre beispielsweise ein Feld oder eine Brache abseits vom Windpark, die gezielt gemäht oder nicht gemäht wird, das legt der Ornithologe fest, um eben dieses Feld zu attraktivieren, dass man die Vögel in diese Richtung lenkt. Das zeigt eine sehr gute Wirkung.
Wir haben da gesehen, dass sich beispielsweise die Rotmilan-Population in den letzten 20 Jahren deutlich erholt hat– und das parallel zum Ausbau der Windkraft. Windkraft und Vogelschutz sind kein Widerspruch und gehen zusammen.
Wenn diese Ausgleichsmaßnahmen und Attraktivitätsflächen funktionieren, also wenn sie nach Errichten des Windrads ein Vogel ansiedelt, ist dann das Spiel nicht gelaufen?
Für uns und unseren Betrieb in erster Linie nicht. Die Tiere sind ja auch nicht dumm. Sie lernen, damit umzugehen, wie wir beispielsweise in Petronell sehen. Dort ist unser Windpark nahe der Donauauen und die Vögel jagen dort. Es funktioniert trotzdem, weil die Tiere eben ausweichen. Die sind intelligent und sehen die Windräder.
Sie haben auch den Nimby-Effekt (Nimby steht für „Not in my backyard“, also etwa „Nicht bei mir zuhause“; Anm. d. Red.) genannt, also Neid unter Anrainern. Ist das bei Voruntersuchungen oder Stakeholder-Untersuchungen schon Thema? Wie begegnet man solchen sozialen Spannungen im Vorfeld?
NIMBY ist bei uns vielleicht besser als Floriani-Prinzip bekannt.
Früher haben wir uns für ein Windrad genau das eine Grundstück gesichert. Das hat bei den betreffenden Nachbarn oft für Neid gesorgt. Wir haben das aufgegriffen und uns überlegt, was kann man da machen kann haben nun ein Flächenpacht Modell entwickelt. Nun sichern wir uns t die gesamte Potenzialfläche. Das ist jene Fläche, wo man theoretisch Windräder bauen könnte. Die ist wegen den Abstandsregeln, Naturschutzgebieten und sonstigem, ohnehin nicht so riesig.
Der Grundeigentümer des Grundstücks, wo das Windrad später stehen wird, bekommt ein bisschen mehr. Wir nennen das „Flächenpacht-Modell“, das greift quasi das Neid-Thema auf und schafft mehr Zufriedenheit. Aber nur weil wir pachten, heißt das noch lange nicht, dass dort dann auch gebaut wird.
Definieren Sie diese Potenzialfläche oder wird sie definiert?
Wir machen in unserem Gis-System zahlreiche Analysen und suchen Flächen, auf denen wir Projekte machen könnten. Es gibt aber Bundesländer, die Vorrangzonen definiert haben. Wir bieten da unsere Unterstützung an und melden auch Flächen ein. Wir haben im Team in den letzten Jahren einen Fokus gesetzt und in ganz Österreich Potenzialgebiete gesucht.
Nur für Windkraft oder für Solarenergie auch?
Für Photovoltaik auch. Da werden wir uns aber sehr darauf fokussieren, in Nähe unserer bestehenden Kraftwerke Flächen zu suchen, damit wir den vorhandenen Netzanschluss nutzen können. Für Photovoltaik machen wir auch gezielte Standortanalysen. Wind ist halt viel schwieriger wegen der Abstands-Regelungen. In Niederösterreich muss man beispielsweise 1200 Meter Abstand zu Wohnbauland einhalten bzw. Naturschutzgebiete und Natura-2000-Gebiete sind auch freizuhalten. Deswegen sind wir da so eingeschränkt
In der Konferenz haben sie auch das Projekt Rainbach im Mühlviertel für eine gelungene frühzeitige Einbindung mit intensiver Bürgerkommunikation genannt. Ist Ihr Projekt als Blaupause für folgende Vorhaben?
Ich würde schon sagen. Da hat vieles sehr gut funktioniert. Wir haben frühzeitig mit dem Bürgermeister gesprochen, der auch sehr erfahren mit Großprojekten ist, weil er die S10 abgewickelt hat. Er steht hinter dem Projekt, und das ist heute auch wichtig, weil sich viele Bürger an Bürgermeisterin und Bürgermeister orientieren. Und dort hat der Bürgermeister aktiv für das Projekt kommuniziert, was sehr wichtig ist, wenn es dann zu Befragungen kommt.
Wie ist das mit neu ins Amt Gewählten? Bieten sie Bürgermeistern auch Unterstützung an?
Natürlich. Das ist ja genau der Punkt. Wir haben eine ganze Reihe verschiedenster Informationsmöglichkeiten. Das stimmen wir mit Bürgermeistern ab, wie sie es gern hätten. Meistens sind das Informationsabende, oft von 16 bis 20 Uhr. Wichtig ist das Format, eben ein „World Café“. Da hat man verschiedene Inseln, Tische, zu verschiedenen Themen, also zum Beispiel zu den Vögeln, zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zum Schall-Thema mit Hör-Stationen, damit man sich vorstellen kann, wie man ein Windrad hören würde. Bei diesem Format kann man einzelne Fragen sehr gut beantworten.
Wenn man beispielsweise eine Podiumsdiskussion macht, schreien immer die Lauten und die, die eine Frage haben, trauen sich nicht fragen.

Es ist ja für viele ein Problem, vor vielen Menschen zu reden und Fragen zu stellen.
Genau. Und darum haben wir gefunden, dass dieses Format sehr gut ankommt. Dazu machen wir Sprechstunden, wo einmal im Monat der Projektleiter vor Ort ist. Das sitzt im Gemeindeamt drei Stunden am Vormittag in einer Gemeinde, drei Stunde in einer anderen Gemeinde. Man kann als Bürgerin, als Bürger, hingehen.
Ich habe das selbst schon gemacht, und ich war dann nicht mehr „die von der Wien Energie“, sondern „die Lisa“ Dazu gibt es natürlich Projekthomepages, wir machen Aussendungen, Infostände und gehen manchmal auch von Tür zu Tür, um mit den Bürgerinnen und Bürgern zu reden und eben die Bedenken anzusprechen.
Einerseits kommt das sehr gut an, aber lustigerweise wird uns trotzdem vorgeworfen, wir würden zu wenig informieren.
Das klingt alles sehr gut. Aber dennoch wird die Energiewende bis 2030 schwierig, stelle ich mir vor.
Das wird natürlich herausfordernd. Wir sind sehr stark jetzt in der Flächensicherung und den ersten Projektprüfungen. Wenn sich die Verfahrensdauer beschleunigen würden, könnten wir den 2030er Zielen näherkommen
Die Frage mit der Energieunabhängigkeit und den stabilen Strompreisen hängt ja nicht nur von einem Ausbau der Kraftwerke oder Windräder allein ab, sondern auch vom Netz. Hält das Netz Schritt?
Die kämpfen mit genau denselben Themen wie wir, also mit den langen Verfahrensdauern, mit Einsprüchen, mit keiner klaren Kommunikation vom Bund. Die haben eins zu eins dieselben Themen wie wir. Sie kriegen Einsprüche, weil ein Mast auf einer Magerwiese steht zum Beispiel. Wir brauchen einfach Klarheit, dass wir die Energiewende brauchen und dazu gehören natürlich auch die Netze. Energieprojekt sollten bei der Interessensabwägung vorrangig betrachtet werden, denn wenn wir die Dekarbonierung nicht schaffen, überlegen die Magerwiesen beispielsweise auch nicht.










