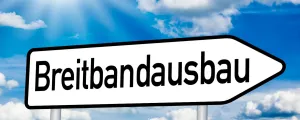© adobe stock photo/Enrico
Brückensanierung
Teufelssteg Lofer: Wie es mit der historischen Brücke nach Sperre weiter geht.
Die Marktgemeinde Lofer steht vor einer großen infrastrukturellen Herausforderungen: Der historische Teufelssteg über die Saalach musste im Oktober 2025 gesperrt werden, nachdem sich der 350 Tonnen schwere Felsbrocken, auf dem die Brücke in Flussmitte aufliegt, stärker als in den Jahren zuvor bewegt hat.
Mit rund 2.100 Einwohnern muss die kleine Tourismusgemeinde nun entscheiden, ob und wie sie eine emotional bedeutsame, aber funktional nicht zwingend notwendige Infrastruktur erhalten kann.
Geologische Situation verschärft sich dramatisch
Die Messungen des geologischen Dienstes des Landes Salzburg zeigen: "Vorher hat man im Halbjahr Verschiebungen von ungefähr vier Zentimetern und jetzt hat man hier 20 bis 30 Zentimeter gemessen", erklärt Fabian Moosbrugger vom geologischen Dienst des Landes Salzburg gegenüber dem ORF Salzburg. Diese Beschleunigung der Felsbewegung wird vor allem durch Hochwasser verursacht, die den Teufelsfelsen stark unterspülen.
Der aktuelle Zustand der 130 Jahre alten Brücke ist kritisch: "Er hat zum Teil Knicke und beim Auflager liegt er nur mehr ein paar Zentimeter auf und das ist zu gefährlich, um drübergehen zu dürfen", so Vizebürgermeisterin Angelika Hofer (ÖVP) im Gespräch mit dem ORF. Eine Nutzung des Stegs ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr vertretbar.
Historische und touristische Bedeutung
Der Teufelssteg wurde erstmals 1896 urkundlich erwähnt und verbindet seit etwa 130 Jahren die Gemeinde mit den Ortsteilen Scheffsnoth und Berau. Für die Bevölkerung ist der Steg durchaus mit vielen persönlichen Erinnerungen verbunden.
Die Legende erzählt, dass der Teufel persönlich den Fels mitten in die Saalach geworfen haben soll, um den Fluss mit zwei Schritten überqueren zu können. Diese mystische Geschichte macht den Steg zu einem touristischen Anziehungspunkt in einer Gemeinde, die vom Tourismus lebt: Lofer verfügt über mehr als 2.500 Gästebetten und punktet mit der Almenwelt Lofer, die 10 Seilbahnen und Lifte sowie 46 Pistenkilometer umfasst.
Der Teufelssteg ist integraler Bestandteil beliebter Wanderrouten und liegt an der spektakulären Kajak-WM-Strecke der Saalach. Seine Sperrung beeinträchtigt nicht nur die lokale Infrastruktur, sondern auch das touristische Angebot in einer Region, die wirtschaftlich stark vom Fremdenverkehr abhängig ist.
Identitätsstiftende Funktion für die Gemeinde
Für die Einheimischen ist der Teufelssteg weit mehr als eine Flussquerung – er ist ein Symbol lokaler Identität. Über Generationen hinweg nutzten Lofer Familien den Steg als Verbindung zwischen den Ortsteilen. Die emotionale Bedeutung zeigt sich darin, dass die Gemeinde trotz vorhandenem Alternativsteg – nur 500 Meter entfernt –am Erhalt des historischen Standorts festhalten möchte.
Diese Bindung ist charakteristisch für kleine Gemeinden, in denen Bauwerke nicht nur funktional, sondern auch kulturell und sozial bedeutsam sind. Der Teufelssteg verbindet nicht nur Ufer, sondern auch Menschen und deren Geschichte mit dem Ort.
Finanzielle Herausforderungen für kleine Kommune
Die Sanierung oder der Neubau des Teufelssteg stellt Lofer vor erhebliche finanzielle Herausforderungen. Als kleine Gemeinde verfügt Lofer über begrenzte Eigenmittel. Die genauen Kosten sind noch nicht bezifferbar und hängen von der gewählten technischen Lösung ab.
Die allgemeine Situation österreichischer Gemeinden ist angespannt: Laut KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung wird erwartet, dass "rund jede zweite Gemeinde eine negative freie Finanzspitze haben wird" und die Liquidität auf einem ähnlich geringen Niveau wie im Krisenjahr 2020 liegt (Quelle: kdz.eu, Gemeindefinanzprognose 2027).
Als Bauherr und Eigentümer trägt die Gemeinde die Hauptverantwortung für die Sanierung der Brücke. Die muss also eine Lösung finden, die sowohl technisch als auch finanziell tragbar ist. Denn sonst verlieren die Bewohner der Ortsteile Scheffsnoth und Berau eine direkte Verbindung, auch wenn ein Alternativsteg existiert. Die emotionale Bindung an den historischen Übergang ist stark.
Vor allem die Tourismuswirtschaft, Hotels, Pensionen, Gastronomie und der Tourismusverband Salzburger Saalachtal sind auf attraktive Wanderrouten angewiesen. Der Teufelssteg ist ein etabliertes touristisches Highlight. Ganz besonders für die Wildwassersportler ist die Saalach ist eine renommierte Kajak-Strecke. Der Teufelssteg ist ein markanter Orientierungspunkt und Teil des Wildwasser-Erlebnisses.
Der geologische Dienst des Landes Salzburg begleitet die Situation in fachlicher Hinsicht. Das Referat Brückenbau, das landesweit rund 1.475 Brückenbauwerke überwacht, kann technische Expertise beisteuern. Über den Gemeindeausgleichsfonds (GAF) und den Katastrophenfonds ist das Land auch als Fördergeber relevant.
Aber auch auf Bundesebene kann die Gemeinde Mittel für die Sanierung bekommen: Über das Kommunale Investitionsprogramm (KIG 2025) stellt der Bund Mittel für kommunale Infrastrukturprojekte zur Verfügung, mit einem erhöhten Bundesanteil von 80 Prozent.
Technische Lösungsoptionen
Die Gemeinde prüft derzeit mehrere Varianten. "Die Alternative ist natürlich, den Stein nicht mehr zu benützen, dass man ihn nicht mehr als Auflager hat. Überlegungen sind, dass man ihn weiter nach oben verlegt oder woanders eine Trasse sucht", erläutert Vizebürgermeisterin Hofer gegenüber dem ORF.
Es gäbe durchaus mehrere Optionen für die Erneuerung des Teufelsstegs:
- Höherverlegung der Trasse Der Steg könnte oberhalb des instabilen Felsens neu errichtet werden, wo stabilere geologische Verhältnisse herrschen. Dies würde aufwendigere Zugangsrampen erfordern, könnte aber touristisch durch bessere Aussichten attraktiv sein.
- Neue Trassenführung Eine vollständige Neutrassierung an einem anderen Standort würde geologische Probleme umgehen, bedeutet aber den Verlust des historischen Standorts und erfordert neue Genehmigungen.
- Durchgehende Konstruktion ohne Mittelauflager Eine moderne Brückenkonstruktion könnte mit Tiefgründung auf beiden Ufern eine durchgehende Spannweite über die Saalach schaffen, ohne den instabilen Felsen zu nutzen. Dies ist technisch anspruchsvoll, aber mit modernen Baumaterialien realisierbar.
- Verzicht auf den Standort Der vorhandene Alternativsteg 500 Meter entfernt könnte ausgebaut werden. Dies wäre die kostengünstigste Variante, würde aber die historische und emotionale Bedeutung des Teufelssteg-Standorts aufgeben.
"Bis wann es eine neue Lösung gibt, ist laut Gemeinde noch nicht abzusehen", heißt es aktuell. Geologische Gutachten und Machbarkeitsstudien müssen die Grundlage für die Entscheidung bilden.
Finanzierungsmöglichkeiten und Förderstrategien
Die Gemeinde kann mehrere Fördertöpfe anzapfen, um die Finanzierungslast zu reduzieren:
Katastrophenfonds des Bundes: Bei Schäden am Vermögen von Gemeinden ersetzt der Katastrophenfonds 50 Prozent des Schadens. Da Hochwasser als Ursache der Felsbewegung identifiziert wurde, könnte eine Förderung möglich sein.
Gemeindeausgleichsfonds (GAF) Salzburg: Der GAF fördert kommunale Infrastrukturprojekte, wobei Straßen (und damit auch Brücken) zu den dominierenden Förderungsbereichen gehören. Die Förderungen bestehen aus nicht rückzahlbaren Zuschüssen, die Förderhöhe richtet sich nach sechs Kriterien, darunter Finanzkraft der Gemeinde, Investitionshöhe und interkommunale Anträge können von 1. Jänner bis 30. April gestellt werden. Die typische Förderquoten liegen zwischen 15 und 25 Prozent.
Kommunales Investitionsprogramm (KIG 2025): Der Bund stellt Geldmittel zur Verfügung, wobei der Ko-Finanzierungsanteil des Bundes auf 80 Prozent erhöht wurde.
Optimaler Förder-Mix: Bei geschickter Kombination der Fördertöpfe könnte Lofer eine Gesamtförderquote von 65 bis 75 Prozent erreichen. Der verbleibende Eigenanteil von 25 bis 35 Prozent müsste durch Gemeindebudget, Rücklagen oder Kommunaldarlehen finanziert werden.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Als Eigentümer und Baulastträger ist die Gemeinde Lofer grundsätzlich für die Infrastruktur verantwortlich. Eine zwingende Baupflicht besteht jedoch nicht, da der Steg nicht essentiell ist – ein Alternativsteg existiert. Die Verkehrssicherungspflicht erforderte jedoch die Sperrung.
Bei Baumaßnahmen muss die Gemeinde das Bundesvergabegesetz beachten. Zudem sind wasserrechtliche Bewilligungen für Bauwerke im oder am Gewässer erforderlich, ebenso wie möglicherweise naturschutzrechtliche Genehmigungen.
Für Förderanträge beim Katastrophenfonds müssen Schadenserhebungskommissionen gebildet werden. "Für Schäden an Gemeindebrücken sind Sachverständige aus den zuständigen Landesabteilungen in die Schadenserhebungskommission hinzuzuziehen", so die rechtlichen Vorgaben.
Vergleichsfälle und Präzedenzien
Die Situation in Lofer ist kein Einzelfall. In der Steiermark wurden 2024 nach schweren Unwettern rund 12 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds für Gemeinden bereitgestellt, "insbesondere an Straßen und Brücken", wie Landesrätin Manuela Khom 2025 gegenüber Kommunal betonte. Dies zeigt, dass der Katastrophenfonds aktiv für Brückenschäden zugänglich ist.
Auch historisch ist der Teufelssteg nicht die erste problematische Brücke in Lofer: 2016 wurde bereits ein neuer Teufelssteg gebaut, nachdem der vorherige bei einem Hochwasserereignis beschädigt wurde.
Das Land Salzburg betreibt ein systematisches Brückenmanagement: Von den rund 1.475 überwachten Brückenbauwerken wurden viele zwischen 1960 und 1980 gebaut und haben nun entsprechenden Sanierungs- oder Neubaubedarf.
Dilemmata zwischen Identität und Wirtschaftlichkeit
Die Gemeinde Lofer steht beispielhaft für ein Dilemma vieler kleiner Kommunen: Wie viel ist Identität wert? Die funktionale Notwendigkeit des Teufelssteg ist begrenzt – es gibt einen Alternativsteg. Rational betrachtet wäre dessen Ausbau die kostengünstigste Lösung.
Doch Kommunalpolitik ist mehr als Kosten-Nutzen-Rechnung. Der Teufelssteg ist Teil der lokalen Erzählung, ein Stück gelebter Geschichte, ein touristisches Alleinstellungsmerkmal.
Diese Spannung zwischen Heimatverbundenheit und Haushaltskonsolidierung wird in Zeiten knapper Gemeindekassen zunehmend konfliktreich. Die finanzielle Situation österreichischer Gemeinden verschärft sich: Das KDZ prognostiziert, dass ohne Gegenmaßnahmen in den nächsten Jahren "eine höhere Zahl an Abgangsgemeinden zu erwarten" ist – Gemeinden also, "die defacto keine eigenen finanziellen Spielräume zur Finanzierung von Vorhaben und damit zur Gestaltung der Gemeinde haben" (Quelle: kdz.eu).
Klimawandel als verschärfender Faktor
Die beschleunigte Felsbewegung durch verstärkte Hochwasser fügt sich in ein größeres Bild: Der Klimawandel erhöht die Intensität von Extremwetterereignissen. Infrastruktur, die Jahrzehnte stabil war, gerät unter Stress.
Die Bundesregierung hat darauf reagiert: 2024 wurde die Dotierung des Katastrophenfonds auf bis zu 1 Milliarde Euro erhöht, "von der im Ausmaß des tatsächlichen Finanzierungsbedarfs Gebrauch gemacht werden wird" (Quelle: bundeskanzleramt.gv.at, 2024). Zusätzlich werden im Rahmen des Bundesforschungs- und Rahmengesetzes jährlich rund 230 Millionen Euro für Wasserbau und Wildbach- und Lawinenverbauung bereitgestellt (Quelle: bundeskanzleramt.gv.at).
Für Gemeinden bedeutet dies: Klimaanpassung wird zur Daueraufgabe. Bestehende Infrastruktur muss resilient gemacht, neue Projekte müssen klimafest geplant werden.
Eine transparente Kommunikation mit der Bevölkerung wird entscheidend sein. Die emotionale Bedeutung des Stegs erfordert einen partizipativen Prozess, bei dem verschiedene Lösungsoptionen diskutiert werden. Innovative Finanzierungsmodelle wie Crowdfunding oder Patenschaften könnten die Bürgerbindung stärken und einen Beitrag zur Finanzierung leisten.
Übertragbare Erkenntnisse für andere Kommunen
Der Teufelssteg bietet wichtige Lehren für kommunale Infrastrukturpolitik:
Frühwarnsysteme: Das systematische Brückenmonitoring des Landes Salzburg ermöglichte es, die Gefahrenentwicklung rechtzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen sind essentiell.
Förder-Know-how: Die Kombination verschiedener Fördertöpfe kann die Finanzierungslast deutlich reduzieren. Kleine Gemeinden sollten sich professionell beraten lassen.
Klimaresilienz: Infrastrukturplanung muss künftige Extremwetterereignisse einkalkulieren. Was heute sicher scheint, kann in 20 Jahren gefährdet sein.
Identität als Faktor: Bei Infrastrukturentscheidungen spielen nicht nur technische und finanzielle, sondern auch emotionale und kulturelle Aspekte eine Rolle. Diese müssen in Entscheidungsprozesse einbezogen werden.
Die Gemeinde Lofer steht exemplarisch vor Herausforderungen, die viele kleine Kommunen in Österreich und darüber hinaus betreffen: Wie können historisch gewachsene, identitätsstiftende Infrastrukturen in Zeiten knapper Budgets und zunehmender Klimarisiken erhalten werden?
Die Antwort wird nicht einfach sein. Sie erfordert technische Expertise, kreative Finanzierungslösungen, politischen Willen und Bürgerbeteiligung. Der Teufelssteg ist mehr als eine Brücke – er ist ein Symbol für die Frage, wie wir mit unserem baukulturellen Erbe umgehen wollen.
Die kommenden Monate werden zeigen, ob der legendäre Teufelssteg eine Zukunft hat – und wenn ja, welche.
Weiterführende Informationen:
- Förderinformationen: www.salzburg.gv.at/gemeindeprojektfinanzierung