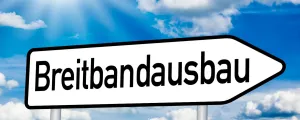Das nächtliche Öffnen von Fenstern ist die energiesparendste Methode, ein Gebäude zu kühlen.
© Artyom - stock.adobe.com
Gebäudetechnik
Nachts lüftet es sich am effizientesten
Das simple Lüften während der Nacht ist im Sommer eine kostensparende und energieeffiziente Methode zum Kühlen von Gebäuden. Für eine automatisch gesteuerte und kontrollierte Nachtauskühlung sprechen etliche Gründe.
In Büros, Schulen und öffentlichen Gebäuden wird es im Sommer oft unerträglich warm. Menschen, Geräte und die Beleuchtung geben ständig Wärme ab. Sonnenstrahlen heizen Fensterglasflächen und somit die Räume zusätzlich auf. Die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Menschen in den Gebäuden lässt in Folge nach.
Damit sich die Personen trotz der hohen Außentemperaturen wohlfühlen und geistig fit bleiben, müssen die Gebäude gekühlt werden. Klimaanlagen erhöhen allerdings signifikant das Investitionsvolumen, die Wartungskosten und den Energieverbrauch eines Gebäudes. Büro- und Verwaltungsgebäude verbrauchen für das Kühlen der Räume im Frühjahr und Sommer häufig sogar mehr Energie als für das Heizen im Herbst und Winter.
Im Vergleich zu einer Klimaanlage ist eine kontrollierte natürliche Lüftung weitaus energiesparender. Sie nutzt für den Luftaustausch die natürlichen Druckunterschiede, die zwischen mindestens zwei Öffnungen eines Gebäudes nach außen herrschen. Diese Unterschiede bestehen bereits bei schwachem Wind. Ventilatoren, die wiederum Energie benötigen würden, sind daher gar nicht notwendig.
Hitze des Tages in der Nacht nach außen leiten
Bei der Nachtlüftung leiten automatisch gesteuerte Fenster die tagsüber entstandene Wärme während der Nacht nach außen und kühle, frische Luft nach innen. Die zugeführte Frischluft sorgt für ein Absinken der Temperatur und ein angenehmes Raumklima. Die kühle Nachtluft ist nicht nur nachhaltig und energieeffizient, sondern gleichzeitig natürlich und umweltfreundlich.
Diese Art der Gebäudeklimatisierung verbindet man in Neubauten immer öfter mit einer thermischen Baukernaktivierung. Dabei werden in Gebäudemassen Rohre verlegt, durch die Wasser als Heiz- bzw. Kühlmedium fließt. Im Idealfall werden energiefressende Klimaanlagen damit obsolet. Die automatische Nachtlüftung eignet sich besonders für jene öffentlichen Gebäude in der Gemeinde, die nicht bewohnt werden, wie das Gemeindeamt, Feuerwehrhaus, Sportstätten, Kindergärten oder Schulen.
Optimal funktioniert eine Nachtlüftung durch moderne Fenstertechnik. Sie sorgt dafür, dass ganze Fensterfronten oder Fenstergruppen automatisch angesteuert werden. Mithilfe einer sensorischen Steuerung lassen sich Lüftungszeiträume festlegen und unkompliziert ändern.
Nachtlüftung auch bei Glasfassaden möglich
Auch bei modernen Glasfassaden mit sogenannten Parallel-Ausstellfenstern ist eine automatische Nachtlüftung möglich. Die Fensterflügel öffnen sich als Ganzes parallel nach außen. So entstehen keine Beeinträchtigungen für die Optik der Glasfassade – etwa durch Spiegelungen bei gekippten Fenstern.
Das parallele Ausstellen des Fensters sorgt zudem für einen optimalen Luftaustausch. Kühle Luft kann von unten einströmen, während gleichzeitig warme, verbrauchte Luft nach oben austritt. Im Vergleich zu gekippten Fenstern erreichen Parallel-Ausstellfenster bei gleicher Öffnungsweite eine deutlich höhere Luftwechselrate.
Voraussetzungen für effiziente Nachtlüftung
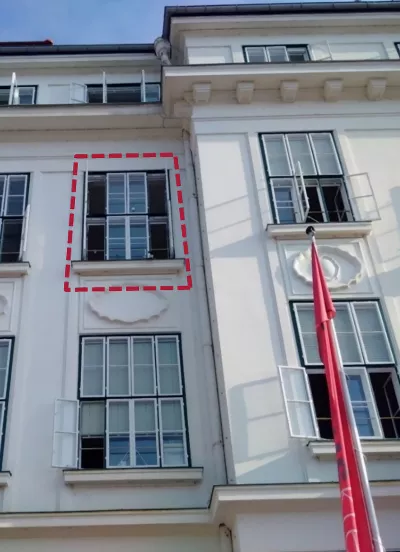
Die Nachtlüftung mit dem gezielten Effekt der Nachtauskühlung funktioniert aber nicht überall. Einige Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Die Außentemperaturen in der Nacht müssen über einen ausreichenden Zeitraum deutlich unter den Temperaturen im Gebäude liegen. Die Qualität der Außenluft muss gut sein, also ohne Gerüche, Schadstoffe oder Feinstaub. Der Einbruchschutz muss gewährleistet bleiben, entweder durch Fenstersicherungen oder durch eine besondere Bauweise, wie etwa Parallel-Ausstellfenster. Ebenso sollte ein baulicher Witterungsschutz gegeben sein.
Lüften mit KI
Markus Winkler ist der Leiter des Zentrums für Bauklimatik und Gebäudetechnik an der Donau-Universität Krems. Mit seinem Team forscht er im Zuge des Projekts „CoolAIR“ und dessen aktuellen Nachfolgeprojekts „CoolBRICK“ genau in Richtung der optimierten Nachtkühlung von Gebäuden.
Bei „CoolAIR“ wurde eine Regelungsmöglichkeit für eine Nachtlüftung am Fenster entwickelt, die auf KI-Methoden basiert. „Wir haben es mit Gebäudemassen zu tun, die mehr oder weniger sehr träge sein können. Wenn bei historischer Bausubstanz einmal die Heizung für ein, zwei Tage ausfällt, dann bleibt die Temperatur zwar abnehmend, aber relativ gut erhalten. Im Sommer ist es ähnlich. Vergisst man einmal zu verschatten, so nimmt die Gebäudemasse die Hitze auf und mildert die Temperaturspitzen ab. Im Idealfall passiert das natürlich erst gar nicht, weil die Verschattung automatisiert gesteuert wird. Diese Lösungen gibt es bereits im Consumer-Bereich wie in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern.“
Eher mehr kühlen als zu wenig

Winklers Team ist jedoch noch einen Schritt weiter gegangen und hat eine sogenannte modellprädiktive Regelung entwickelt.
Bei einer herkömmlichen, simplen sensorischen Steuerung gehen die Fenster auf, es wird gelüftet und somit gekühlt, bis der Innenraum eine angenehme Temperatur hat, und dann schließen sich die Fenster wieder. Maßgeblich dafür sind nur die Parameter der momentanen Raumtemperatur und der Außentemperatur.
Die modellprädiktive Regelung hingegen berücksichtigt auch die Speichermasse des Gebäudes. Sie kalkuliert mit ein, dass sich durch die aufgeheizten Wände die Raumtemperatur neuerlich erhöht, sobald die Lüftung beendet wird. Sie lüftet deshalb derart, dass die Gebäudemasse selbst auch noch abkühlen kann. So lange, bis es zu einem definierten Zeitpunkt – naheliegenderweise zu jenem, wenn Menschen das Gebäude nutzen wollen (zum Beispiel um sieben, acht oder neun Uhr morgens) – gerade noch nicht als zu kühl empfunden wird.

„Wir müssen Räume über Nacht entwärmen, damit wir ein Reservoir an kühleren Bauteiltemperaturen haben. Wie müssen diese Speichermasse quasi entladen“, erklärt Winkler. Das heißt, anstatt dass sich die Fenster um zwei Uhr nachts schon wieder schließen, weil die Raumluft in diesem Moment angenehme 21 °C erreicht hat, wird bei der modellprädiktiven Regelung weiter offen gelassen. Wände, Decken, Fußböden, Möbel und wo auch immer sonst noch Wärme eingespeichert wurde, können abkühlen.
Die Fenster schließen sich so, dass zum festgelegten (morgendlichen) Zeitpunkt die Raumtemperatur gerade an der unteren Behaglichkeitsgrenze liegt. Davor können die Innentemperaturen durchaus auch darunter liegen, denn es befindet sich ja niemand in den Räumlichkeiten. Besonders cool daran: Die entwickelte Regelung kann nach dem Plug & Play-Prinzip ohne Einbindung in eine übergeordnete Gebäudeleittechnik implementiert werden.
Nachtlüftung benötigt kaum Strom
Diese passive Kühlmethode ist ganz besonders im Lichte der EU-Gebäuderichtlinie interessant, die den gesamten Gebäudebestand der EU bis 2050 auf „Nullemissionsstandard“ bringen will. Im Vergleich zu einer Klimaanlage benötigt die Nachtlüftung nämlich so gut wie keine Energie.
„Die Model Predictive Control (MPC) benötigt pro Nacht nur zwei Mal Strom. Einmal zum Öffnen und einmal zum Schließen der Fenster.
In der Regel handelt es sich dabei um 24-Volt-Motoren, die für die Dauer von ein bis zwei Minuten aktiv sind, je nachdem, wie schnell die Fenster geöffnet werden sollen und wie laut und leise das erfolgen soll“, erklärt Winkler und ergänzt: „Natürlich kann eine aktive Kältetechnik oder eine reversible Wärmepumpe, wenn sie mit regenerativem Strom aus einer eigenen PV-Anlage versorgt wird, auch Energiekosten haben, die gegen null streben. Das hängt von der Größe der Kälteanlage und jener der PV-Anlage ab.“
Verschattung bereits einplanen
Jemand, der sich überlegt, wie er einen Bestand im Sommer kühlen kann, muss sich zwingend mit der Raumkühllast beschäftigen. Die kann er sehr niedrig halten, wenn er bauphysikalisch mit dem Planer alles richtig macht. Grundsätzlich ist die Frage immer, wie groß die Heizlast einer zu kühlenden Zone ist.
Der Bauphysiker muss mit dem Planer, Umbauplaner oder Sanierer die passiven Einrichtungen zur Verschattung mitbedenken. Diese verbrauchen in der Regel auch keinen Strom, wie etwa Lamellen, Raffstores, Auskragungen, Bepflanzungen oder Ähnliches.
Wird auf solche Maßnahmen verzichtet, sind die Kältebedarfe dieser Zonen um das x-Fache erhöht. „Die beste Vorgehensweise lautet immer: zuerst verschatten und dann das verbliebene Quäntchen an Raumkühllast gegebenenfalls aktiv wegkühlen“, weiß Winkler.
Versuche an zwei identen Testgebäuden

Für das Projekt „CoolBRICK“, das normative Grundlagen für die Planung des Kühlpotenzials resilienter Nachtlüftung von Gebäuden liefern soll, wurden zwei idente Testgebäude in Salzburg digital nachgebildet und die Temperaturentwicklung in verschiedensten Szenarien anhand dieser digitalen Zwillinge untersucht.
Durch reale Langzeitmessungen an diesen Testgebäuden auf dem Areal der Bauakademie Salzburg sind die Ergebnisse parallel zusätzlich validierbar. Für „CoolAIR“ hat die Burghauptmannschaft Österreich in der Hofburg ein Büro adaptieren lassen. So konnten die Forschungsteams die einfache Nachrüstbarkeit insbesondere im denkmalgeschützten Bestand erfolgreich nachweisen.