Entscheidend ist die Umsetzung
„Die Verordnung zu VRV 2015 ist nach 41 Jahren fertig.“ Dass das BMF damit ein bisschen übers Ziel geschossen hat, zeigt KOMMUNAL.
Im Verhandlungsprozess zur neuen Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) hat sich der Österreichische Gemeindebund auf allen Ebenen für möglichst einfache Regelungen eingesetzt, die von großen wie auch kleinen Gemeinden umsetzbar sind und gleichzeitig die notwendige Transparenz und Datenvergleichbarkeit gewährleisten. Die VRV 2015 wurde nunmehr am 19. Oktober 2015 im Bundesgesetzblatt (BGBl. II Nr. 313/2015) kundgemacht, die zugehörigen Erläuterungen wurden einige Wochen danach, am 9. November 2015, auf der Homepage des Finanzministeriums veröffentlicht.
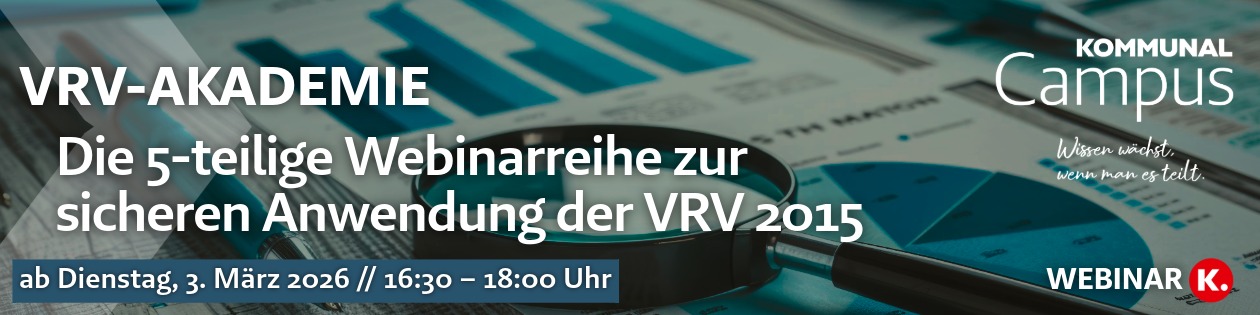
„Verordnung fertig – Thema nach 41 Jahren abgearbeitet“, so lautete an prominenter Stelle mehrere Wochen lang die Botschaft auf der BMF-Website nachdem der Finanzminister seine VRV 2015 trotz des noch nicht abgeschlossenen Verhandlungsprozesses erlassen hat. Ganz glücklich gewählt war diese Botschaft aber nicht. Zum einen ist sie schon rechnerisch nicht ganz nachvollziehbar, da die alte VRV 1996 erlassen und seither fünfmal novelliert wurde. Man kann aber angesichts der vorangegangenen medialen Schwarz-Weiß-Diskussion keinem Web-Redakteur übel nehmen, dass dieser den Eindruck gewonnen hat, dass ab der Heiligenbluter Vereinbarung von Bund, Ländern und Gemeinden, die seit 1974 einen wesentlichen Meilenstein für die Harmonisierung der Haushaltsrechte bildet, ebendiese Harmonisierung von Länder- oder Gemeindeseite durch das Einvernehmlichkeitsprinzip verhindert worden wäre. Vor allem aber ist das Thema längst nicht „abgearbeitet“. Vielmehr fängt die Arbeit eigentlich erst an, und es bleibt zu hoffen, dass die vom Bund zugesagte Unterstützung bei der Umstellung, in fachlicher Hinsicht oder auch was Unterlagen betrifft, nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt. Unterstützung finanzieller Natur, nur damit niemand auf falsche Ideen kommt, hat der Bund bei dieser von ihm gewünschten Reform ja von vornherein ausgeschlossen. Es gilt das Prinzip der eigenen Kostentragung.
Aufhebung der VRV 2015 nicht unwahrscheinlich
Wie ein roter Faden durch die rund zweijährigen Verhandlungen zu dieser Haushaltrechtsreform der Länder und Gemeinden zog sich die Frage, was darf der Finanzminister eigentlich alles verordnen. Auch ein gemeinsames Rechtsgutachten das Bundes und der Länder konnte hier keine Klarheit bringen. Angesichts des Umfangs und in vielen Bereichen auch der Regelungstiefe sind die Länder aber sehr zuversichtlich, dass der Finanzminister mit der VRV 2015, die ihm in § 16 Abs. 1 des Finanz-Verfassungsgesetzes (im Einvernehmen mit dem Rechnungshofpräsidenten) eingeräumte Verordnungsermächtigung zur Regelung von Form und Gliederung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Gebietskörperschaften überschritten hat. Dementsprechend wurde am 3. 11. 2015 von der Landeshauptleutekonferenz vereinbart, die VRV 2015 vom Verfassungsgerichtshof überprüfen zu lassen.
Eigene 15a-Vereinbarung der Länder
Ebenfalls am 3. 11. 2015 unterzeichneten die Landeshauptmänner die lediglich zwischen den Ländern vereinbarte 15a-Vereinbarung über gemeinsame Grundsätze der Haushaltsführung. Ursprünglich war ja eine Bund-Länder-15a-Vereinbarung zur Regelung jener Inhalte geplant, die nicht in Bundeskompetenz liegen (materielle Inhalte abseits von Form und Gliederung der Rechnungsabschlüsse), gegen Ende der Verhandlungen vertrat der Bund jedoch mehr und mehr die Position, omni-kompetent zu sein, also alles in der VRV regeln zu können, bis auf die Gemeindeverbände und den Rechnungsstil (doppisches oder kamerales Buchen), was den Landesgesetzgebern obliegt. Da die Länder, wie auch die Gemeindebünde, weiterhin zum inhaltlichen Verhandlungsergebnis von vergleichbaren und umfangreich mit Beilagen versehenen Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen stehen, und dies auch im Fall einer teilweisen oder vollständigen Aufhebung der VRV 2015 wegen Nichtzuständigkeit des Verordnungsgebers, haben die Länder den VRV-Text samt Anlagen in eine 15a-Vereinbarung gegossen. Nicht ganz korrekt waren die entsprechenden Aussagen der Bundes- und Landespolitiker, wonach die VRV „wortident“ oder „deckungsgleich“ in dieser 15a-Vereinbarung steht, denn beim Geltungsbereich wurden die Gemeinden ebenso herausgestrichen wie beim Inkrafttreten. Dementsprechend finden sich auch keine Aussagen darüber, ob und wie von Länderseite weiterführende landesgesetzliche Maßnahmen für die Ebene der Gemeinden geplant sind. Auch fanden die in der VRV noch ungeregelten Gemeindeverbände keinen Einzug in diese 15a-Vereinbarung.
Strukturierter Prozess soll Kosten gering halten
Aus kommunaler Sicht zeigt diese Vorgangsweise, dass die Länder den Gemeinden bei der Umsetzung der VRV 2015 große Autonomie einräumen. In diesem Sinne werden die Gemeindebünde bereits in diesen Wochen erste Koordinationsgespräche mit den Dienstleistern (EDV- und Beratungsfirmen) und den Ländern (Gemeindeaufsichtsbehörden) führen. Vorhandene Erfahrungen und Erwartungen zur Umsetzung sollen diskutiert und an der Entwicklung eines gemeinsamen Umsetzungsprozesses soll gearbeitet werden. Man könnte sagen, das Ziel ist die Entwicklung eines gemeinsamen Mindeststandards für das Produktdesign und die dafür nötigen Schnittstellen zur EDV. Der Gemeindebund hat im Rahmen einer Reihe von Pilotgemeinden in mehreren Bundesländern bereits umfangreich erarbeitet, wo die Unterschiede am Weg zwischen den Buchhaltungssystemen hin zur erforderlichen Datenbereitstellung nach VRV 2015 gegenüber der alten VRV 1997 liegen, wo mögliche Fehlerquellen sind und um welche Aspekte diese vorhandenen und bewährten Systeme (im Wesentlichen geht es um die Ergänzung einiger Konten und um die Vermögensbewertung) zu erweitern sind. Man muss also das Rad nicht neu erfinden (gerade das kostet viele teure Beratungstage) und kann den Dienstleistern bereits konkrete Ansatzpunkte geben, damit die einzelnen Implementierungen in den Gemeinden straff gehalten werden können.
Es bleibt genug Zeit zur Umsetzung
Das 3-Komponenten-System der VRV 2015 ist von den großen Städten (spätestens) im Haushaltsjahr 2019 und von den Städten und Gemeinden bis 10.000 Einwohnern mit 2020 anzuwenden, die VRV 1997 tritt erst Ende 2018 bzw. 2019 außer Kraft. Es ist damit ausreichend Zeit für einen gut durchdachten, auf breitem Konsens basierenden Umstellungsprozess und ebenso für die Diskussion der nötigen landesgesetzlichen Nachfolgeregelungen, etwa was die Ansatzpunkte für genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte der Gemeinden betrifft. KOMMUNAL wird über die weiteren Entwicklungen auf dem Weg zu einer möglichst einheitlichen und kostengünstigen Umsetzung weiter berichten.











