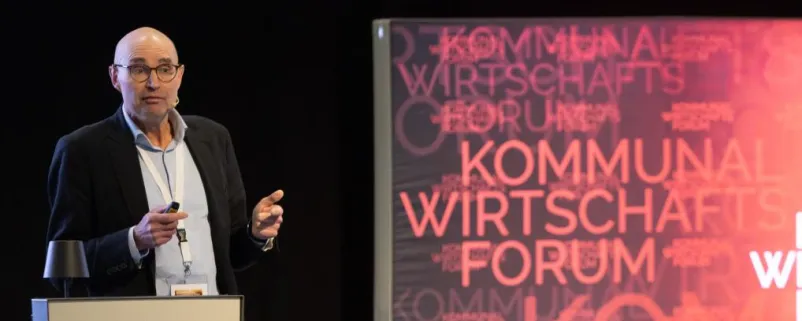
Johannes Fechner: „Man kann nur steuern, was man sieht.“
© Jürg Christandl
Energie sichtbar machen – und effizient nutzen
Die Keynote von Johannes Fechner beim Kommunalwirtschaftsforum 2025 in Saalfelden zeigte eindrucksvoll, warum Gemeinden eine zentrale Rolle in der Energiewende einnehmen – und wie sie dieser Verantwortung gerecht werden können.
„Schaffen wir das?“ – Mit dieser scheinbar simplen Frage leitete Johannes Fechner seine Keynote beim Kommunalwirtschaftsforum ein. Gemeint war nicht weniger als die Energiewende selbst: Können wir unsere Energieversorgung in Österreich, in Europa und global auf erneuerbare Quellen umstellen? Und was bedeutet das konkret für Gemeinden?
Die Antwort liegt im Kleinen – und damit im Lokalen. Denn während internationale Klimaziele diskutiert werden, entscheidet sich die tatsächliche Umsetzung in den Gemeinden. Fechner machte klar: Wer Energieeffizienz ernst nimmt, beginnt vor der eigenen Haustür. Genau dort, wo Gemeinden Bauwerke errichten, Straßen erhalten, Kindergärten betreiben oder die Wasserversorgung sichern.
Kommunale Aufgaben mit Energiebrille betrachten
Die Vielzahl kommunaler Aufgaben – von Schulen über Kulturzentren bis zur Müllabfuhr – sind allesamt mit Energieverbrauch verbunden. Damit werden Gemeinden automatisch zu zentralen Akteuren der Energiewende. Die gute Nachricht: Sie haben nicht nur Verantwortung, sondern auch Gestaltungsmacht.
Fechner erinnerte daran, dass laut Steiermärkischer Gemeindeordnung (§ 74) alle kommunalen Haushalte nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu führen sind. Energieeffizienz ist dabei nicht Kür, sondern Pflicht. Spätestens die EU-Richtlinie 2023/1791 macht dies deutlich: Öffentliche Einrichtungen müssen ihren Energieverbrauch jährlich um mindestens 1,9 Prozent senken und 3 Prozent ihrer beheizten bzw. gekühlten Gebäude renovieren. Ein klarer Handlungsauftrag – nicht nur an die Technik, sondern an die Strategie.
Energie wahrnehmen – der erste Schritt zur Effizienz
„Man kann nur steuern, was man sieht“, so Fechners Leitsatz. Wahrnehmung sei daher der entscheidende erste Schritt. In vielen Gemeinden fehle es nicht an der Motivation, sondern an konkreten Daten zum Energieverbrauch. Fechner riet zu niederschwelligen Maßnahmen wie einem Thermografie-Tag, der sichtbar macht, wo Energie verloren geht – etwa durch unzureichend gedämmte Gemeindebauten oder ineffiziente Heizsysteme.
Solche Bilder sprechen eine klare Sprache: Energieverschwendung wird greifbar. Und mit dieser Sichtbarkeit steigt auch die Akzeptanz für notwendige Maßnahmen – bei politischen Entscheidungsträgern ebenso wie bei Bürgerinnen und Bürgern.
Energie hat ihren Preis – und ihren Wert
Besonders eindrucksvoll war Fechners Versuch, den wahren Wert von Energie zu veranschaulichen. Wer eine Kilowattstunde Strom selbst erzeugen wolle, müsse rund 30 Stunden auf einem Hometrainer treten. Für einen Euro Energieaufwand braucht es also drei Kilowattstunden – eine körperlich spürbare Relation. Diese einfache Rechnung führt zu einer grundsätzlichen Frage: Ist Energie heute zu teuer oder zu billig?
Fechner plädierte dafür, Energie wieder als kostbare Ressource zu begreifen. Denn obwohl die Energieeffizienz in den letzten Jahren gestiegen sei, wachse der Gesamtverbrauch weiter – durch mehr Wohnfläche, steigenden Komfort und eine Vielzahl an Elektrogeräten. Effizienz allein reicht daher nicht. Es braucht auch ein neues Verständnis von Suffizienz – also der Frage: Was ist genug?
Rebound-Effekte vermeiden, Strategien stärken
Fechner wies auf einen oft übersehenen Effekt hin: den sogenannten Rebound oder Bumerang-Effekt. Er beschreibt das Phänomen, dass Effizienzgewinne durch erhöhten Verbrauch wieder zunichte gemacht werden. Ein Beispiel: Neue Heizsysteme sind effizienter, doch weil sie günstiger laufen, wird mehr geheizt. Die Lösung? Ganzheitliche Konzepte, die auch Konsistenz (verträgliche Stoffkreisläufe) und Suffizienz einbeziehen.
Die Gemeinde hat dabei mehrere Hebel in der Hand. Fechner stellte die räumliche Energieplanung als strategisches Instrument vor. Sie verknüpft lokale Wärmenachfrage mit geeigneten Versorgungsstrukturen und führt Einzelmaßnahmen zu einem Gesamtkonzept zusammen. Die Entwicklung solcher Konzepte ist kein Selbstzweck, sondern Grundlage für langfristige Versorgungssicherheit und Klimaschutz.
Gemeinsam handeln – mit Unterstützung
Fechner betonte abschließend, dass Gemeinden nicht allein agieren müssen. Unterstützungsangebote gibt es viele – etwa durch e5-Gemeinden, Klimaundenergiemodellregionen (KEM) oder Programme wie klimaaktiv. Auch Landesagenturen stehen beratend zur Seite. Wichtig sei jedoch, Verantwortung nicht zu delegieren, sondern selbst ins Handeln zu kommen.
Mit einem klaren Appell verabschiedete sich Fechner von seinem Publikum: „Nehmen Sie Energie bewusst wahr – und gestalten Sie aktiv die Zukunft Ihrer Gemeinde.“ Ein Appell, der nicht nur in Saalfelden nachhallen dürfte.










