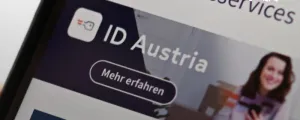Alexander Pröll: „KI ist die größte Disruption unserer Zeit. Sie wird nicht verschwinden, also müssen wir uns aktiv damit auseinandersetzen.“
Interview
„Wir brauchen einen Staat, der KI-tauglich ist“
Verwaltung digitalisieren, Daten intelligent verknüpfen, Bürger:innen entlasten: Staatssekretär Alexander Pröll sieht Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie für Österreichs Gemeinden. Im KOMMUNAL-Interview spricht er über KI-Gigafabriken, den Aufbau von Kompetenzzentren und die Frage, wie Gemeinden von Anfang an Teil dieser Transformation sein können.
KOMMUNAL: Herr Staatssekretär, Sie haben kürzlich gesagt, dass bis 2038 rund 44 Prozent der Bediensteten in der öffentlichen Verwaltung in Pension gehen werden. Kann Digitalisierung – speziell KI – helfen, diese Lücke zu schließen?
Alexander Pröll: Die Vision ist ein schlanker, effizienter Staat, der moderne Technologie nutzt, um Beamtinnen und Beamte bestmöglich zu unterstützen. Es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen, sondern sie zu entlasten. Viele Tätigkeiten – etwa Förderanträge oder Bescheide – sind auf allen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden) ähnlich. Ziel ist es, hier gemeinsame, einheitliche Lösungen zu entwickeln, damit wir effizienter zwischen den Ebenen arbeiten können.
Was brauchen die Gemeinden konkret, um da mitziehen zu können?
Die Gemeinden sind extrem wichtige Treiber. Es geht nicht darum, KI anstelle des Gemeindeamts zu setzen, sondern das Verhältnis Bürger–Verwaltung effizienter zu gestalten. Wichtig wäre ein enger Austausch zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Gerade im Bereich IT-Konsolidierung haben wir gesehen, wie es nicht laufen sollte – etwa mit zig verschiedenen Video-Tools während Corona. Wir müssen hier zu Shared Services kommen, wo möglich.
„Es geht nicht darum, KI anstelle des Gemeindeamts zu setzen, sondern das Verhältnis Bürger–Verwaltung effizienter zu gestalten.“
Die ID Austria übernimmt zunehmend digitale Services, die bisher klar bei den Gemeinden lagen – etwa Meldewesen oder die Beantragung von Wahlkarten. Wird hier langfristig kommunale Zuständigkeit ausgehöhlt? Und wie kann verhindert werden, dass Bürgerinnen und Bürger im digitalen Raum die Gemeinde „verlieren“?
Ich verstehe diese Sorge. Aber es ist nicht die Absicht, dass Gemeindeämter durch digitale Zentralisierung ersetzt werden. Die ID Austria ist ein wichtiges Instrument, um Services effizienter zugänglich zu machen – aber das bedeutet nicht, dass die Gemeinde als Anlaufstelle verschwindet. Vielmehr müssen wir überlegen, wie wir digitale Schnittstellen so gestalten, dass sie intuitiv über die Gemeindewebseiten erreichbar bleiben. Da sehe ich auch Potenzial in der Reformpartnerschaft mit dem Städte- und Gemeindebund. Ziel muss sein, dass sich Bürger:innen im digitalen Raum genauso gut zurechtfinden wie im Amt – und das bedeutet, die Gemeinde bleibt sichtbar und eingebunden.
Grundsätzlich gibt es viele Schnittmengen mit den Gemeinden – eben die Wahlkarte ist ein Service in Kooperation mit den Gemeinden und den Ländern. Die Gemeinde kann aber frei wählen, wo und wofür sie die ID Austria verwenden wollen. Im Rahmen der BLSG (Bund-Länder-Städte-Gemeinde) – Runde werden solche Projekte immer abgestimmt und Best-Practice Lösungen geteilt. Zudem wurde im Jahr 2023 eine gemeinsame E-Government Strategie verabschiedet.
Gemeinden haben oft Datenschutzbedenken bei KI. Gibt es Überlegungen zu in Österreich gehosteten Lösungen?
Ja, wir setzen auf eine europäische Lösung, um digitale Souveränität zu sichern. Ziel ist eine KI, die datenschutztechnisch sicher ist – also keine zentralisierte Datensammlung, sondern Trennung nach Bedarf. Zusätzlich wollen wir mit Partnern eine KI-Gigafabrik (siehe Kasten 1) in Wien errichten. Das wäre ein Leuchtturmprojekt für Rechenleistung und Infrastruktur in Österreich.
Stichwort digitale Bildung – wie wird die Verwaltung vorbereitet? Gibt es Schulungen?
Die 6000 Workshops (siehe unten), die wir im Rahmen der digitalen Kompetenzoffensive anbieten, richten sich an die ganze Bevölkerung – von Schüler:innen bis Pensionist:innen. Für die Verwaltung selbst ist geplant, dass die neue KI in die Ausbildung integriert wird. Bei der ELAK-Schulung für Verwaltungsbedienstete wird KI ein Thema sein, und neue Bedienstete sollen gleich mit den richtigen Tools starten.
Gibt es gezielte Angebote für Gemeinden, etwa Webinare oder Tools?
Teilweise ja – es gibt Workshops mit speziellen Verwaltungsschwerpunkten. Aber ich sehe den Bedarf, das noch strukturierter und breiter anzulegen. Vielleicht können wir gemeinsam ein Tool entwickeln, das über die Kommunalakademie oder andere Kanäle verbreitet wird. Ziel ist: flächendeckende Schulung, insbesondere angesichts der bevorstehenden Pensionierungswelle.
Wie steht es um die Altersverifikation im Social-Media-Bereich – auch hier sind Gemeinden oft erste Ansprechpartner?
Der Digital Services Act bringt neue Regelungen auf europäischer Ebene. Österreich diskutiert Altersverifikation ab 14. Wichtig ist, dass Plattformen in die Pflicht genommen werden, aber auch Bildung in Schulen muss Medienkompetenz vermitteln. Gemeinden werden bei der Umsetzung eine Rolle spielen, aber es braucht auch den Schulterschluss mit Eltern und Schulen.
Ist es denkbar, dass KI bei politischen Entscheidungen eingesetzt wird – z. B. wie ein US-Bürgermeister es vorhat?
Entscheidungen wird weiterhin der Mensch treffen, aber die KI wird Entscheidungsgrundlagen liefern – etwa durch das Zusammenfassen von Wahrscheinlichkeiten. Der Einsatz wird stark zunehmen, aber wir müssen sehr genau schauen, mit welchen Daten wir die KI füttern.
Im Zusammenhang mit dem digitalen Amt – viele Services wandern vom Gemeindeamt in den digitalen Raum. Gibt es Bestrebungen, das besser zu verzahnen?
Ja, das ist Teil der Reformpartnerschaft mit Städte- und Gemeindebund. Ziel ist, digitale Services bürgernah zu gestalten – und das heißt auch, dass Gemeinde-Websites ein guter Einstiegspunkt für digitale Amtswege bleiben sollen. Die Datenflüsse müssen dabei unter höchsten Datenschutzstandards effizient verschränkt werden.
Was ist für Sie der zentrale Punkt beim Thema Digitalisierung?
KI ist die größte Disruption unserer Zeit. Sie wird nicht verschwinden, also müssen wir uns aktiv damit auseinandersetzen. Es ist eine Chance – für die Verwaltung, für die Wirtschaft, für jeden Einzelnen. Österreich darf hier nicht abgehängt werden. Es braucht Mut zur Innovation und ein gemeinsames Verständnis, dass Digitalisierung eine Zukunftsfrage ist – für den Staat und für unsere Gesellschaft.
Ein Thema, das oft untergeht, ist das Datenmanagement. Wie sieht Ihre Strategie aus, wenn es darum geht, Daten zwischen den Verwaltungsebenen effizient und sicher zu verschränken?
Es gibt den sogenannten Registersystemverbund (RSV), der genau darauf abzielt: Die Daten sollen laufen, nicht die Bürger. Natürlich mit klaren Zugriffsbeschränkungen, aber grundsätzlich ist es sinnvoll, dass Schnittstellen geschaffen werden und Systeme miteinander sprechen – unter Wahrung höchster Datenschutzstandards.
Datenschutz gilt vielen als wichtigstes Prinzip – gleichzeitig wird er manchmal als Innovationsbremse gesehen. Wie sehen Sie das?
Datenschutz ist wichtig, keine Frage. Wir trommeln auch permanent für Datenschutz, aber gleichzeitig geben Bürgerinnen und Bürger auf Social Media freiwillig alles preis. Ich denke, wir müssen für die Menschen den Nutzen von Daten in den Vordergrund stellen – ohne die Sicherheit zu vernachlässigen.
Sie haben zuletzt auch mehrfach die Bekämpfung von Antisemitismus – was ja auch zu Ihren Agenden gehört – als politische Priorität betont. Gibt es hier Überschneidungen mit Ihren Digitalisierungsagenden – etwa im Hinblick auf Hass im Netz oder extremistische Inhalte auf Social Media?
Ja, absolut. Wir haben in Österreich als eines der ersten EU-Länder eine nationale Strategie gegen Antisemitismus auf den Weg gebracht. Ein Update dieser Strategie wird im November vorgestellt.
Für mich liegt der Zusammenhang mit der Digitalisierung klar auf der Hand: Der starke Anstieg antisemitischer Vorfälle – rund 30 Prozent – spielt sich heute maßgeblich im digitalen Raum ab. Das betrifft Social Media, Kommentarspalten, Foren. Deshalb wird unser Fokus bei der Weiterentwicklung der Strategie stark auf die Online-Ebene gerichtet sein. Es braucht dafür einen Schulterschluss mit Ländern und Gemeinden, denn Prävention und Bewusstseinsbildung müssen vor Ort stattfinden, nicht nur auf Bundesebene.
Der Österreichische Gemeindebund ist als aktives Mitglied im Forum gegen Antisemitismus eng in die bundesweiten Bemühungen im Kampf gegen Antisemitismus eingebunden. Diese Zusammenarbeit schafft eine wichtige Schnittstelle zwischen der Bundes- und Gemeindeebene und ermöglicht eine gezielte Abstimmung gemeinsamer Maßnahmen. Gemeinden können zudem für spezifische Projekte in diesem Themenbereich Förderungen beim Land oder Bund beantragen, wodurch lokale Initiativen wirkungsvoll unterstützt und gestärkt werden.
Was ist eine „KI-Gigafabrik“?
Der Begriff „KI-Gigafabrik“ bezeichnet ein groß angelegtes Rechen- und Infrastrukturzentrum, das speziell für die Entwicklung, das Training und den Betrieb Künstlicher Intelligenz ausgelegt ist. Gemeint ist damit nicht eine klassische Produktionsstätte, sondern ein hochleistungsfähiger Standort, an dem immense Datenmengen verarbeitet und KI-Modelle betrieben werden können.
In der Praxis umfasst eine solche Gigafabrik:
- Extrem leistungsfähige Rechenzentren mit spezialisierten Servern und GPUs (Grafikprozessoren), die für maschinelles Lernen ausgelegt sind.
- Hochsichere Dateninfrastrukturen, oft mit eigener Anbindung an Energienetze und Kühlungssysteme.
- Zugang für Forschung, Verwaltung und Wirtschaft, z. B. durch Shared Services oder Plattformlösungen.
- Energiebedarf im Gigawattbereich, weshalb Standortfragen (z. B. Nähe zu Stadtwerken oder nachhaltigen Energiequellen) eine große Rolle spielen.
In Österreich wird derzeit an einer Bewerbung für eine solche europäisch geförderte KI-Gigafabrik gearbeitet. Ziel ist es, Österreich auf europäischer Ebene als eigenständigen Technologiestandort zu positionieren.
6.000 Workshops für digitale Kompetenzen
Im Rahmen der Digitalen Kompetenzoffensive bietet der Bund aktuell 6.000 Workshops unter dem Titel „Digital Überall“ an, die sich an die gesamte Bevölkerung richten – von Schüler:innen bis Senior:innen. Ziel ist es, breitflächig digitale Grundbildung zu vermitteln, insbesondere zu Themen wie Online-Behördengänge, Internetsicherheit, künstliche Intelligenz oder der Umgang mit digitalen Endgeräten.
Die Workshops sind kostenlos und finden in ganz Österreich statt – häufig direkt in Gemeinden, Volkshochschulen, Schulen oder Bibliotheken. Zusätzlich dazu laufen seit Frühjahr 2025 auch die sogenannten „Digital Überall Plus“-Reihen: Dabei handelt es sich um vertiefende Angebote mit 12 bis 18 Unterrichtseinheiten, bei denen auch KI-Kompetenzen, kreative Anwendungen und konkrete Alltagstools thematisiert werden. Diese Plus-Reihen werden in Kooperation mit über 60 anerkannten Erwachsenenbildungsträgern angeboten und können auch von Gemeinden selbst organisiert oder gebündelt beauftragt werden.
Besonders interessant: Gemeinden haben seit Mitte 2024 die Möglichkeit, gezielt einen kostenlosen Basis-Workshop für ihre Bürger:innen zu buchen – und das über eine zentrale Plattform. Auch Anfragen zu Schwerpunktthemen (z. B. „KI in der Verwaltung“, „Sicher online für 60+“ oder „Digitale Behördenwege für Familien“) sind möglich und werden von den zuständigen Bildungspartnern individuell organisiert.
Wer in der Gemeindeverwaltung tätig ist – ob als Amtsleiter:in, Bürgermeister:in oder Bildungsbeauftragte:r – sollte prüfen, ob es in der eigenen Gemeinde bereits ein Workshop-Angebot gibt, oder ob ein Termin angefragt werden sollte. Die Nachfrage ist groß – und die Rückmeldungen aus den Pilotgemeinden zeigen: Die Menschen wollen digitale Hilfestellung, gerade in strukturschwächeren Regionen.
Alle Infos zu den Terminen, Inhalten, Formaten und zur Buchung finden sich auf der offiziellen Website der Digitalen Kompetenzoffensive.
Registersystemverbund: Der digitale Weg der Verwaltungsdaten
Der sogenannte Registersystemverbund (RSV) ist eine zentrale Säule der Verwaltungsdigitalisierung in Österreich. Dahinter steht die Idee, dass Bürger:innen ihre Daten nicht bei jeder Behörde neu angeben müssen, sondern dass staatliche Stellen sie – unter klar geregelten Voraussetzungen – zwischen einander austauschen können. Ziel ist es, Verwaltungsprozesse einfacher, schneller und bürgerfreundlicher zu gestalten.
In der Praxis bedeutet das: Wer etwa einen Antrag auf Wohnbeihilfe, einen Meldezettel oder eine Bauverhandlung einreicht, soll in Zukunft nicht mehr sämtliche Angaben selbst liefern müssen. Die notwendigen Informationen – wie Name, Adresse, Familienstand oder Unternehmensdaten – werden über vorhandene staatliche Register wie das Zentrale Melderegister (ZMR), das Firmenbuch oder das Bildungsregister bezogen. Die Kommune kann so auf geprüfte, aktuelle Daten zugreifen, ohne dass mehrfach Formulare auszufüllen oder Dokumente beizubringen sind.
Besonders für Gemeinden, die oft als erste und wichtigste Schnittstelle zur Verwaltung fungieren, bringt der RSV große Chancen. Weniger Rückfragen, geringerer Personalaufwand, beschleunigte Verfahren – all das kann durch intelligenten Datenaustausch möglich werden. Doch die Umsetzung ist nicht ohne Herausforderungen: Die technische Anbindung ist je nach Gemeinde unterschiedlich weit fortgeschritten, Schnittstellen sind teils veraltet oder unvollständig, und das Personal muss im Umgang mit den neuen Möglichkeiten geschult werden. Auch Fragen der Zugriffsrechte und Datenqualität müssen laufend geklärt werden, um Missverständnisse oder Datenschutzpannen zu vermeiden.
Rechtlich fußt der RSV unter anderem auf dem E‑Government-Gesetz sowie auf einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Das Prinzip lautet: „Die Daten sollen fließen – nicht die Bürger.“ In der Umsetzung erfordert das aber ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden – mit dem Ziel, dass Bürger:innen tatsächlich spüren: Die Verwaltung denkt mit.