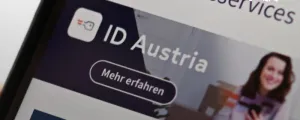Gemeindebundpräsident Johannes Pressl, Kommunal Geschäftsführer Michael Zimper, FLGÖ Obmann Reinhard Haider, Millstatt´s Amtsleiter Peter Pirker, Kommunikationsexpertin Ingrid Brodnig und Moderator Christian Schleritzko
© KOMMUNAL/Stückler
FLGÖ Podiumsdiskussion
Direkter Draht auf allen Kanälen
Heute wird in Gemeinden auf vielerlei Weise kommuniziert. Persönlich in geselliger Runde, über das gedruckte Gemeindeblatt oder über Push-Nachrichten auf das Handy, in punkto Kommunikation ist Kreativität gefragt. Wie weit die österreichischen Gemeinden auch die neuen Kommunikationskanäle nutzen, wurde im Rahmen der FLGÖ Fachtagung in einer Expertenrunde diskutiert.
Moderiert von Christian Schleritzko diskutierten Ingrid Brodnig (Buchautorin und Kommunikationsexpertin), Michael Zimper (GF Kommunalverlag), Johannes Pressl (Gemeindebundpräsident), Reinhard Haider (FLGÖ-Obmann und Amtsleiter von Kremsmünster) und Peter Pirker (Amtsleiter Millstatt, Kärnten).
Kommunikation im Wandel
Die Gemeindezeitung liegt nach wie vor im Briefkasten. Doch daneben blinkt das Smartphone mit Push-Nachrichten der Gemeinde-App. Die Bürger diskutieren in Facebook-Gruppen über lokale Themen. Und der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin bloggt täglich über das Geschehen im Ort. Willkommen in der Realität österreichischer Gemeinden 2025.
Doch wie geht man mit dieser Vielfalt um? Wie schützt man sich vor Cyberangriffen und Hasskommentaren? Und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Kommunikation von Gemeinden mit ihren Bürgerinnen und Bürgern? Und wie schafft man ausgewogene Kommunikationsmaßnahmen, die alle Gemeindebürgerinnen und Bürger erreichen?
Kremsmünster als Vorreiter und im Team erfolgreich
Reinhard Haider, Amtsleiter in Kremsmünster, gilt österreichweit als Digitalisierungsvorreiter. Sein Erfolgsrezept ist einfach: Sowohl analog als auch digital zu denken. "Die Gemeindezeitung hat ein sehr hohes Vertrauenselement und deswegen werden wir weiter großen Wert darauf legen. Natürlich wird vieles davon auf der Webseite gespielt, und auch über Gem2Go an die Haushalte verschickt. Das ist uns ganz wichtig, aber auch die analogen Medien sollten wir nicht vernachlässigen", erklärt er seine Strategie
Gleichzeitig nutzt seine Gemeinde alle digitalen Kanäle sehr konsequent. Seit der Corona-Zeit werden Gemeinderatssitzungen in Kremsmünster gestreamt. Online-Sprechstunden ergänzen persönliche Termine. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in den Ressourcen. "Es ist zum Teil ein Aufnahmekriterium in der allgemeinen Verwaltung, dass Mitarbeiter öffentlichkeitsarbeits-affin sind", erklärt Haider.
Heute arbeitet in Kremsmünster ein dreiköpfiges Medienteam. Es trifft sich wöchentlich und plant die Kommunikation strategisch.
Millstatt setzt auf persönlichen Kontakt
Österreichs Gemeinden gehen eigene Wege. Peter Pirker, Amtsleiter der Kärntner Tourismusgemeinde Millstatt, setzt weiterhin stark auf den persönlichen Kontakt. "Bei uns am Gemeindeamt ist dieser persönliche Kontakt zu den Bürgern das Wichtigste", sagt Pirker.
Dennoch nutzt auch Millstatt digitale Kanäle. Die Gemeinde-App informiert Bürger und Touristen gleichermaßen. Die Gemeindezeitung erscheint sechsmal im Jahr. Besonders erfolgreich ist die Zusammenarbeit mit dem regionalen Tourismusverband. "Wir haben eine zentrale Kommunikationsplattform", erklärt Pirker. "Die Kommunikation findet einheitlich statt. Das ist ein Riesenvorteil, weil eine Message viel mehr Leute erreicht."
Wenn Hacker zuschlagen: Cloud statt lokaler Server
Die Diskussion um Kommunikationskanäle ist wichtig. Doch was passiert, wenn plötzlich gar nichts mehr geht? Cyberangriffe auf Gemeinden nehmen zu. Korneuburg war wochenlang lahmgelegt. Die Kosten waren enorm.
Auch Kremsmünster war betroffen. "Ein bis zwei Tage waren wirklich gestanden", erinnert sich Haider. "Alle Dateien wurden verschlüsselt." Die Gemeinde konnte das Problem mit einem lokalen IT-Dienstleister lösen. Doch die Konsequenz war klar: "Heute sind wir in der Cloud. Dort werden die Cyberangriffe geblockt."
Die Daten liegen nun zentral auf Servern des Landes und des Gemeindeservicezentrums. Lokale Speicherung gibt es kaum noch. "Sollten wir Opfer eines Cyberangriffs werden, müssten wir auf externe Hilfe zurückgreifen", räumt Haider ein. "Wir sind als Gemeinde zu klein für eigenes IT-Personal."
1.400 Gemeinden nutzen eine Plattform
Michael Zimper, Geschäftsführer des österreichischen Kommunalverlages kennt die Herausforderungen der Gemeinden genau. Seine These ist ernüchternd: "Viele Gemeinden haben das Problem, dass gar nicht kommuniziert wird. Und gar nicht zu kommunizieren bedeutet, dass der kritische Kommentar besser durchkommt."
Zimper sieht einen Wandel der Kommunikationsräume. "Früher war es das Wirtshaus. Warum war das so? Weil dort kommuniziert wurde." Heute verlagere sich die Kommunikation auf digitale Plattformen, Apps und Social Media. "Wenn es diese Kommunikation nicht mehr gibt, stirbt die Seele des Ortes."
Die Gemeinde-App Gem2Go nutzen mittlerweile 1.400 Gemeinden in Österreich, Südtirol und Deutschland. Neu ist eine Kooperation mit News-Diensten. Künstliche Intelligenz kuratiert dabei Medienberichte über die jeweilige Gemeinde. "Es geht nicht darum, Fake News zu produzieren", stellt Zimper klar. "Sondern zu kuratieren: Was passiert gerade in verschiedenen Medien über uns?"
Glaubwürdigkeit als größter Trumpf
Die Diskussion um KI führt zu einer zentralen Frage: Wem kann man noch vertrauen? "Zukünftig wird wichtiger werden, wer der Absender der Information ist", prognostiziert Zimper. Interviews könnten heute von jeder KI produziert werden. "Mittlerweile schaue ich mir genau an: Wer hat dieses Interview publiziert?"
Hier haben Gemeinden einen entscheidenden Vorteil. Studien zeigen ein hohes Vertrauen der Bevölkerung in die lokale Verwaltung. "Wenn wir sagen, das steht in der Zeitung und das ist wichtig, dann wird es geglaubt", so Zimper. "Der Absender ist wichtig."
Täglich bloggen seit der Pandemie
Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, kennt beide Seiten. Als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde kommuniziert er seit Jahren digital. "Mir war immer klar: Wenn du nicht kommunizierst, dann wird über dich so geredet, wie man es sich gerade zusammendenkt", sagt Pressl.
Seine Lösung war ein Blog. Und dieser sich zum wichtigsten Kommunikationskanal. Seit dem 13. März 2020 schreibt Pressl täglich. "An einem Tag hatte ich 14.000 Zugriffe", erinnert er sich an den Beginn der Pandemie. "Da merkst du: Ich muss jetzt schreiben."
Seine "Frühstücks-News" sind mittlerweile fixer Bestandteil des Gemeindealltags. Die Community ist stark gemeindebezogen. Wenn Pressl einmal nicht schreibt, kommen die Fragen. Doch der Blog ist mehr als Information. Er ist Frühwarnsystem.
Proaktiv kommunizieren statt reagieren
Ein Beispiel aus dem Alltag: Eine Gemeinderätin meldet spätabends, dass die Altpapiertonne nicht geleert wurde. Pressl ahnt, dass sich daraus etwas entwickeln könnte. Am nächsten Morgen setzt er eine Statusmeldung ab: "Altpapier bitte stehen lassen." Problem erkannt, Problem gebannt.
"Es ist das Vorgreifen auf Dinge, die sich entwickeln können", erklärt Pressl sein Prinzip. Seine zentrale Botschaft an alle Gemeindeverantwortlichen: "Macht die Zone mit dem Guten voll, damit kein anderer mehr Platz hat."
Pressl denkt dabei auch an neue Möglichkeiten. Seine Gemeinde hat einen Avatar erstellt. Künstliche Intelligenz übersetzt seine Botschaften in andere Sprachen. "Ich spreche auf Türkisch eine Ansage an meine Gemeindebürger", berichtet er. "Das funktioniert."
Seine Philosophie: "Ich frage mich nicht, ob wir Angst vor diesen Dingen haben müssen. Sondern ich glaube, dass wir proaktiv diese Möglichkeiten nutzen sollten."
Mit Fragen statt Vorwürfen reagieren
Doch was tun, wenn es trotzdem zu Angriffen kommt? Wenn in Social-Media-Gruppen die Wut hochkocht? Ingrid Brodnig, Expertin für digitale Kommunikation, hat klare Empfehlungen. "Viele können Deeskalation im Alltag bereits beherrschen", sagt sie. "Dieses Deeskalieren kann man auch online praktizieren."
Ihr Tipp: Mit Fragen einsteigen statt mit Gegendarstellungen. "Woher hast du die Information?" Diese einfache Nachfrage könne bereits vieles verändern. Entweder eskaliere die Situation weiter. Oder die Person merke: "Der Amtsleiter selbst hat geantwortet. Da kann ich noch was retten."
Brodnig warnt vor einer verbreiteten Falle: Zu viel Aufmerksamkeit für negative Akteure. "Wenn in einer Gruppe zehn neue Postings sind, fokussieren wir uns oft auf das Problematische", beobachtet sie. "Dabei vergessen wir die konstruktiven Beiträge."
Positive Beiträge belohnen
Ihre Empfehlung: Bewusst die konstruktiven Kommentare beantworten. "Wenn wir immer auf die Negativakteure blicken, zeigen wir: Wenn du so auftreten kannst, kriegst du unsere Aufmerksamkeit. Das ist belohnend." Die positiven Kommentatoren würden hingegen ignoriert. "Das nächste Mal denken sie sich: Dann schreibe ich es nicht mehr."
Wichtig sei auch, nicht alles selbst beantworten zu wollen. Verbündete einbinden, Tourismusverbände, engagierte Mitarbeiter. "Diese Netzwerke muss man offline pflegen", betont Brodnig. "Wir vergessen oft, dass online die gleiche Beziehungspflege wichtig ist."
Die Finger sind schneller als das Hirn
Moderator Schleritzko bringt ein weiteres Problem auf den Punkt: "Ich habe teilweise das Gefühl, dass die Finger bei manchen schneller sind als das Hirn." Der wertschätzende Umgang sei in Social Media oft verloren gegangen. "Was früher in der Gemeindeebene fast immer gegeben war."
Das Problem: Einmal geschrieben, bleibt es stehen. Andere lesen es, teilen es weiter. Gerüchte entstehen. "Das aus der Welt zu schaffen wird schwer", gibt Schleritzko zu bedenken. Umso wichtiger sei die proaktive Kommunikation.
Pressl fasst seine Erfahrung so zusammen: "Wir haben schon ein Problem, dass wir nicht sicher sind in diesen Medien. Man kriegt die Sicherheit nur mit Beschäftigung." Sein Rat: Mut haben, ausprobieren. "Das kann auch zu Fehlern führen. Aber ich würde jedem raten, sich nicht zu scheuen."
Ein Blick in die Zukunft
Wohin entwickelt sich die Gemeindekommunikation? Wird der persönliche Kontakt verschwinden? Die Podiumsteilnehmer sind sich einig: Nein. Im Gegenteil.
"Die Gemeinde ist der letzte aktuelle Problemlöser für die Bürger", ist Peter Pirker überzeugt. "Das heißt, wir bleiben bestehen." Man solle die Chancen neuer Tools ergreifen, nicht die Dinge fürchten. Michael Zimper sieht einen scheinbaren Konflikt: Einerseits werde die Kommunikation individueller. Andererseits müsse sie genau deswegen wieder persönlicher werden. "Weil es nicht mehr klar sein wird: Mit wem spreche ich eigentlich?"
Persönliche Begegnungen werden wichtiger
Seine Prognose: "Events, Konferenzen, Marktplätze werden wichtiger. Weil ich mich wieder dorthin wenden können muss, wo ich hundertprozentig sicher bin: Das hat der jeweilige gesagt." Die Gemeinde als Ort werde dadurch wieder wichtiger. "Der Lebensraum Gemeinde wird wichtiger werden."
Auch Ingrid Brodnig plädiert für mehr Offline-Begegnungen. "Wenn Gemeinden klug sind, versuchen sie diese analogen Treffpunkte und Räume auszubauen", sagt sie. "Dort habe ich die höhere Wahrscheinlichkeit für ein Gemeinschaftsgefühl." Wichtig sei, dass Menschen das Gefühl hätten: "Da komme ich zusammen, da fühle ich mich als Teil einer größeren Einheit."
Johannes Pressl ergänzt: "Spröde bürokratische Wege können online bewegt werden. Aber wertvolle Momente der Begegnung sollten ausgebaut werden."
Drei zentrale Erkenntnisse
Erfolgreiche Gemeindekommunikation braucht Strategie und Ressourcen. Ein durchdachtes Konzept, ein Team, das sich kümmert, regelmäßige Betreuung. Wer einfach nur einen Kanal öffnet, wird scheitern. Analog und digital ergänzen sich. Die Gemeindezeitung behält ihren Stellenwert als Vertrauensmedium. Digitale Kanäle ermöglichen schnelle, zielgruppengerechte Information. Die Mischung macht den Erfolg. Proaktive Kommunikation schützt besser als Abwehr. Wer selbst die Informationen liefert, nimmt Gerüchten den Wind aus den Segeln. Wer das Gute betont, lässt Negativem weniger Raum. Und wer konstruktive Beiträge belohnt, fördert eine positive Diskussionskultur.
Mut als Schlüssel zum Erfolg
Die vielleicht wichtigste Botschaft der Diskussion kommt von Johannes Pressl: "Man kriegt die Sicherheit nur mit Beschäftigung." Gemeinden sollten nicht aus Angst vor Fehlern auf digitale Kommunikation verzichten. Sie sollten mutig sein, ausprobieren, lernen.