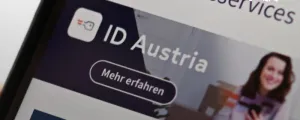© adobe stock photo/Fidel
LSZ Behördenkonferenz
GenAI in der Verwaltung
Beim ersten von zwei Panel talks auf der LSZ Behördenkonferenz diskutierten Expertinnen und Experten über die Rolle von Generativer KI in der öffentlichen Verwaltung. Viele Aspekte, wie Fachkräftemangel und dadurch erforderliches Wissensmanagement, ethische Herausforderungen und nicht zuletzt die rechtliche Einordnung wurden erörtert.
Moderiert wurde die Runde von Thomas Goiser. Auf dem Podium saßen Georg Nesslinger, Leiter der Abteilung E-Government Unternehmen im Bundeskanzleramt, Petra Stummer, CIO der NÖ Landesregierung, Marlon Possard, Dozent und Forscher an der Hochschule Campus Wien, sowie Gernot Silvestri, Bereichsleiter für Growth und Digital Experience bei adesso Austria. Die Expertinnen und Experten beleuchteten den Einsatz von KI aus praktischer, rechtlicher und gesellschaftlicher Perspektive.
Praxisnahe Anwendungen in Niederösterreich
Petra Stummer berichtete über die konkrete Nutzung von KI in der Landesverwaltung Niederösterreich. Die Verwaltung habe bereits seit über eineinhalb Jahren Prozesse etabliert, die künstliche Intelligenz einbeziehen. Ein Schwerpunkt liege auf der Verarbeitung großer Textmengen. Der Aufbau einer lokalen Infrastruktur und die Schaffung eines entsprechenden Rechtsmodelles seien ebenfalls im Fokus.
„Bei Gutachten können wir durch KI schneller Inhalte aus externen Dokumenten herausziehen und zusammenfassen.“
Auch im Unternehmensserviceportal sei KI erfolgreich im Einsatz, beispielsweise bei der automatisierten Suche nach Förderungen.
Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen
Georg Nesslinger betonte ebenfalls, dass KI in der Verwaltung nicht losgelöst von rechtlichen Vorgaben betrachtet werden könne. Der AI-Act setze neue Standards, die in der öffentlichen Verwaltung umgesetzt werden müssten.
„Die DSGVO war schon ein großer Schritt, jetzt ist der AI-Act das neue Regelwerk. Das betrifft natürlich auch die öffentliche Verwaltung – und viele tun sich mit der Umsetzung schwer.“ Für Nesslinger sind Schulungen der Mitarbeitenden entscheidend, um rechtliche und ethische Anforderungen zu erfüllen.
„Das ist keine Kür, sondern Pflicht. Auch ethische Kompetenz ist gesetzlich vorgeschrieben und nicht nur ein ‚nice-to-have‘.“
Er betonte zudem die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Umgang mit KI.
„KI verbraucht enorme Rechenressourcen, das darf die Verwaltung nicht ausblenden.“
KI als Werkzeug gegen Fachkräftemangel
Gernot Silvestri hob hervor, dass KI insbesondere dabei helfen könne, dem wachsenden Fachkräftemangel aufgrund der demografischen Entwicklung zu begegnen. „Wir müssen Wissen für weniger Menschen verfügbar machen. KI kann hier beim Wissensmanagement eine wichtige Rolle spielen.“
Er verwies jedoch auf die Notwendigkeit der menschlichen Endkontrolle, um Fehler durch sogenannte „Halluzinationen der Modelle“ zu vermeiden.
„Halluzinationen sind ein bekanntes Problem. Die Ergebnisse müssen immer überprüft werden – die Endkontrolle bleibt beim Menschen.“
Silvestri sieht großes Potenzial in intelligenten Systemen, die Daten aus unterschiedlichen Quellen kombinieren und voneinander lernen.
Bürgernähe und gesellschaftliche Verantwortung
Marlon Possard stellte die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt der Diskussion. Digitalisierung dürfe nicht dazu führen, dass Menschen ausgeschlossen werden.
„Die Verwaltung ist für die Menschen da. Wir dürfen niemanden zurücklassen.“
Er nannte ein konkretes Beispiel aus dem Alltag:
„Meine Nachbarin konnte keinen Arzttermin mehr telefonisch buchen, nur noch online. Solche Entwicklungen zeigen, dass es analoge Alternativen braucht.“
Possard betonte auch die Bedeutung europäischer digitaler Souveränität.
„Die meisten Modelle stammen aus den USA. Europa muss unabhängiger werden und eigene Lösungen entwickeln – digitale Souveränität ist der Schlüssel.“
Balance zwischen Innovation und Verantwortung
Die Diskussion machte deutlich, dass die Verwaltung zwischen Effizienz, Fachkräftemangel, Rechtssicherheit und Bürgernähe balancieren muss. KI ist Werkzeug zur Prozessoptimierung, wobei in der österreichischen Verwaltung besonders auf rechtliche und ethische Vorgaben zu achten sind. Der Fachkräftemangel fordert von der Verwaltung ein klares Vorgehen im Bereich des Wissensmanagements und die gesellschaftliche Verantwortung im Einsatz von KI darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die digitale Souveränität, die in ganz Europa, und natürlich speziell in Österreich vorangetrieben werden müsse. Generative KI ist gekommen, um zu bleiben. Die Menschen, die sie sie nutzen, müssen Wege finden, Innovation und Verantwortung zu verbinden.