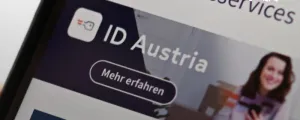Die österreichische Delegation vor dem Denkmal von Gustav Ernesaks, dem Organisators der estnischen Sängerfeste zu Zeiten der sowjetischen Besatzung Estlands.
Gemeindebundreise nach Estland
Ins Musterland des E-Government machte sich eine Delegation heimischer Bürgermeister auf, um von den Esten zu lernen, was man alles online erledigen kann.
"Es gibt bei uns nur drei Dinge, die mit Behörden zu tun haben, die man nicht online erledigen kann“, erklärt Henri Pook, estnischer IT-Experte, den Besuchern aus Österreich: „Heiraten, sich scheiden lassen oder ein Grundstück kaufen. Für diese drei Dinge muss man persönlich erscheinen, alles andere können die Menschen in Estland online erledigen.“
Seit Jahren schon gilt der kleine baltische Staat als Vorreiter beim E-Government. E-Voting, also die elektronische Stimmabgabe, ist hier eine Selbstverständlichkeit. Bei den jüngsten Kommunalwahlen haben 20 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme auf diesem Weg abgegeben. Die Wahlbeteiligung erhöhe sich dadurch messbar bzw. sinke weniger schnell, sagen die estnischen Experten. „Interessanterweise sind wir mit diesem Modell in zwei Bevölkerungsgruppen besonders erfolgreich: Bei den jungen Leuten und vor allem auch bei älteren Menschen, für die der Weg ins Wahllokal beschwerlich ist“, berichtet Pook weiter.
Sicherheitslücken schließen ist ein ständiger Prozess
Die Sicherheitsbedenken von IT-Experten nehme man ernst. „Wir wissen, dass das System nie perfekt sein kann. Wenn wir eine Sicherheitslücke schließen, dann taucht eine andere theoretische Möglichkeit auf. Es ist also ein permanenter Prozess, der nie zu Ende ist. Man muss immer dahinter sein, die Gefahren kennen und sie aktiv bekämpfen.“
Dennoch sei es bisher zu keinen nennenswerten Problemen gekommen. „Wir haben das weitgehend im Griff, ich persönlich glaube, dass bei anderen Wahlformen, wie etwa der Briefwahl, die Gefahren größer und vielfältiger sind.“
Die vielfältigen Online-Angebote estnischer Behörden seien, sagen die Experten, auch ein wesentlicher Grund dafür, dass die Verwaltung des baltischen Staates deutlich weniger personalintensiv als vergleichbare Verwaltungen in Europa sei. Die OECD-Zahlen bestätigen diese These eher nicht. In deren Vergleich zwischen OECD-Staaten wird Estland ein „Anteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst“ ausgewiesen, der deutlich über dem Durchschnitt liegt.
Rund 20 Prozent der estnischen Arbeitnehmer sind im öffentlichen Dienst angestellt. Der OECD-Schnitt liegt einige Prozentpunkte darunter. In Österreich arbeiten übrigens rund 16 Prozent aller Arbeitnehmer für den öffentlichen Dienst (inkl. Kammern, Sozialversicherungen und staatliche Betriebe), das ist spürbar unter dem OECD-Durchschnitt.
Verwaltungs- und Gemeindereform ist im Gange
Online Anwendungen oder der Ausbau von E-Government sind freilich nicht der einzige Bereich, in dem Estland seine Verwaltung weiter reformieren und letztlich auch reduzieren will. Derzeit ist eine große Verwaltungs- und Gemeindereform im Gange, die mit Jahresbeginn 2018 in Kraft treten wird.
213 Gemeinden gab es bisher, in wenigen Monaten sollen es nur noch 79 sein. Um das mit Österreich vergleichen zu können, muss man das in ein sichtbares Verhältnis setzen. Estland ist flächenmäßig ungefähr halb so groß wie Österreich und hat nur 1,3 Millionen Einwohner, davon leben mehr als 400.000 in der Hauptstadt Tallinn.
Ländlicher Raum ist dünn besiedelt
„Der ländliche Raum ist hier also deutlich dünner besiedelt als in Österreich“, merkt Gemeindebund-Chef Alfred Riedl an. Er stand an der Spitze der rund 40 österreichischen Bürgermeister, die im Rahmen einer Bildungsreise Estland besuchten. „Wir machen diese Reisen in andere europäische Länder jedes Jahr zwei Mal, um uns einen Eindruck zu verschaffen, wie kommunale Strukturen und Verwaltungen in anderen Ländern sind“, erklärt Riedl. „Dieser Blick über den Tellerrand hat uns schon oft die Augen geöffnet und viele Male gezeigt, dass die österreichischen kommunalen Strukturen eigentlich gut funktionieren und eine stabile Grundlage sind, die sehr nah am Bürger arbeitet.“
Unumstritten ist die Gemeindereform auch in Estland nicht. „Man erwartet sich natürlich auch bei uns durch die ‚Vergrößerung‘ der Gemeinden leistungsfähigere und bessere Dienstleistungen“, sagt Sirje Ludvig, leitende Mitarbeiterin des estnischen Gemeindebundes (EMOVL). „Es ist schwer vorherzusagen, ob dieser Effekt auch tatsächlich eintreten wird.
Der Bürgermeister der neu entstandenen Gemeinde Saue Vald, Anders Laisk, ist ein Befürworter der Reform. „Das Ziel sind Gemeinden mit Einwohnerzahlen zwischen 15.000 und 20.000 Menschen. Unsere Gemeinde hat sich sehr früh auf den Weg gemacht, um diese Fusion vorzubereiten. Wir haben das zu einem Zeitpunkt begonnen, an dem es noch keine detaillierten Pläne der Zentralregierung gab. Dadurch hatten wir einen großen Vorteil, viele Fragen untereinander haben wir zeitgerecht besprechen und verhandeln können.“

Die Regierung selbst hatte die Verwaltungsreform unmittelbar nach einer Wahl im Jahr 2015 beschlossen und auf den Weg gebracht. Mit einem sehr ambitionierten Zeitplan. In nur zwei Jahren sollten die Fusionen durchgezogen werden, um mit 1. Jänner 2018 in Kraft treten zu können.
Innerhalb des ersten Jahres konnten die Gemeinden freiwillige Fusionen in die Wege leiten und vorbereiten. Gemeinden, die nicht selbst aktiv wurden, mussten mit Zwangsfusionen rechnen.
„In rund 20 Fällen gibt es noch höchstgerichtliche Verfahren“, berichtet Sirje Ludvig weiter. „In diesen Fällen ist natürlich völlig unklar, ob die Zwangsfusion hält und tatsächlich in wenigen Monaten vollzogen werden kann.“ Für freiwillige Zusammenschlüsse gab es hohe staatliche Prämien.
Das Ziel der Reform soll naturgemäß kein Selbstzweck sein. „Im Zuge dieses Prozesses wurden auch die Leistungen, die Gemeinden erbringen sollen, vereinheitlicht“, so Bürgermeister Anders Laisk. „Das ist sehr wichtig, weil damit klarer wird, was Pflichtaufgaben und was zusätzliche Angebote sind, die man nur erbringen kann, wenn das Geld dafür übrig bleibt.“
Kinderbetreuung nicht gratis
Die Bemühungen machen vor nahezu keinem Bereich halt. Medizinische Versorgung, Schulstandorte, Kinderbetreuung, alles steht auf dem Prüfstand. Die Kinderbetreuung ist auch in Estland Aufgabe der Gemeinden.
„Wir haben gelernt, dass es hier überall Elternbeiträge für die Betreuung gibt“, so Gemeindebund-Chef Alfred Riedl. „Diese Beiträge liegen bei 70 bis 90 Euro pro Monat, haben also ein ähnliches Niveau wie bei uns in Österreich, nur sind hier die Einkommen deutlich niedriger. Das ist deshalb interessant, weil es bei uns ja eher immer die Diskussion gibt, was alles kostenlos angeboten werden soll.“ Im Gegensatz zu Österreich stehen auch die Schulen in direkter Zuständigkeit der Kommunen.
Schulbücher gibt es kaum noch, alles läuft digital
„Die Standorte sind bei uns vermutlich durchwegs größer, schon allein deshalb, weil wir die gemeinsame Schule der sechs- bis fünfzehnjährigen Kinder haben“, sagt der Bürgermeister als die Delegation seine Schule besucht. 900 Kinder werden hier unterrichtet. Sie sind – wie 95 Prozent der estnischen Schulen – im E-Schoolbook-Programm. Das heißt: Tablets ab der ersten Schulstufe, Laptops ab der fünften Schulstufe. Schulbücher gibt es kaum noch, alles läuft digital. Auch der Kontakt zu den Eltern kann vollständig online abgewickelt werden. Hausübungen, Fehlstunden, Schulnachrichten, alles ist digital möglich.
In Fall von Saue Vald scheint die Fusion erfolgreich gewesen zu sein. Vor wenigen Wochen wurden die Gemeindevertretungen der nunmehr neuen Gemeinden gewählt, Anders Laisk hat mit seiner Liste 49 Prozent und damit eine deutliche Wiederwahl erreicht. „Der entscheidende Punkt ist sicher, dass man die Menschen in so einen Prozess einbeziehen muss“, so Laisk. „Wir hatten unzählige Bürger/innenversammlungen, Meetings, Informationsveranstaltungen. Das ist aufwändig, hat aber dazu geführt, dass unsere Verwaltung sich hoffentlich verbessern wird.
50 Prozent der Einnahmen für Kinderbetreuung und Bildung
In der Finanzierung der Kommunen gibt es Parallelen zu Österreich. „Der zentralstaatliche Finanzierungsanteil ist jedoch deutlich höher“, berichtet Riedl. Mehr als 80 Prozent der kommunalen Mittel kommen über Zuweisungen des Zentralstaates. „In Österreich heben wir zwei Drittel unserer Einnahmen über Steuern und Gebühren selbst ein, das ist schon ein Unterschied.“
In der Ausgabenstruktur müssen die estnischen Gemeinden fast 50 Prozent der Einnahmen für den Bereich Kinderbetreuung und Bildung aufwenden, rund zehn Prozent für Sozialleistungen, weitere zehn Prozent für Verwaltung. Das Gehalt der Bürgermeister/innen ist für estnische Verhältnisse hoch. Mit rund 3.000 Euro brutto kann der Chef einer 20.000 Einwohner-Gemeinde rechnen, das ist fast das Dreifache des Durchschnittseinkommens im Land. „In der Privatwirtschaft würde ich jedoch mit diesen Anforderungen wahrscheinlich mehr verdienen“, sagt Laisk.
Mit vielen neuen Erkenntnissen kehren die österreichischen Ortschefs nach Hause zurück. „Wir haben ganz sicher einen großen Handlungsbedarf im E-Government“, weiß Alfred Riedl. „Da waren wir Anfang des Jahrtausends im europäischen Vergleich weit vorne, diesen Vorsprung haben wir eingebüßt. Online-Behördenwege müssen für die Menschen einfach, aber trotzdem sicher sein. In Estland sagt man: alles, was mehr als drei Klicks braucht, ist den Bürger/innen oft schon zu viel. Daher sind viele Formulare schon durchs Einloggen der Bürger vorab ausgefüllt. Wir werden diese Erkenntnisse in unsere Arbeit mitnehmen und intensiv darüber nachdenken, was davon wir übernehmen können.“
Nächstes Ziel Sofia
Die nächste Fach- und Bildungsreise des Österreichischen Gemeindebundes findet vom 16. bis 19. Mai statt und führt in die bulgarische Hauptstadt Sofia. Wenn Sie Informationen zur Teilnahme erhalten wollen, wenden Sie sich bitte an service@gemeindebund.gv.at.