
Bischof Hermann Glettler: „Arme hoch, tief durchatmen, über sich hinauswachsen.“
Kommunale Sommergespräche
Ein Bischof zum Aufwärmen und Europa am Prüfstand
Die Friedensdividende ist vorbei, Europa verschläft Schlüsseltechnologien, und Demokratie ist weltweit auf dem Rückzug. Am zweiten Tag der Kommunalen Sommergespräche ging es nicht mehr um Nahversorgung und Pflege – sondern um die großen Linien. Mit einer Botschaft: Gemeinden sind längst keine Zuschauer, sondern Teil des Spiels.
Es ist früher Vormittag in Bad Aussee. Die Bürgermeister reiben sich noch den Schlaf aus den Augen, da bittet Bischof Hermann Glettler die Gäste im Saal, aufzustehen. Arme hoch, tief durchatmen, „über sich hinauswachsen“. Ein paar kichern, die meisten machen mit. Gymnastik mit geistlichem Beigeschmack – und ein passender Auftakt für einen Tag, der ganz im Zeichen der „großen Fragen“ stehen sollte.
Glettler redet nicht lange um den heißen Brei: Er spricht von „kollektiver Nervosität“, vom Rückzug in Privates und vom Verlust von Ortszentren. Sein Credo: Gemeinden und Kirchen müssten enger zusammenarbeiten, Räume öffnen und „Zukunftsduft“ verströmen. Als Beispiel nennt er die belgische Stadt Mechelen, einst Synonym für Kriminalität und Perspektivlosigkeit. Heute gilt sie als Musterbeispiel für gelungene Integration und Bürgernähe – dank klarer Regeln, aber auch dank „Kümmerern“, die sich professionell um Jugendliche, Randständige und Abgehängte kümmern. „Solche Modelle brauchen wir auch bei uns“, mahnt er. Denn sonst füllen jene die Lücke, „die mit Angst Politik machen“.
Oberst Bachmann: Die Friedensdividende ist vorbei

Nach dem Aufwärmen folgt wieder ein „Schlag in die Magengrube“. Oberst Lukas Bachmann, Offizier im österreichischen Generalstab, spricht über Sicherheit. Kein Pathos, kein Säbelrasseln – nur klare Worte: „Die Friedensdividende ist vorbei.“ Der Satz hängt wie ein kalter Luftzug im Saal.
Bachmann zeichnet ein realistisches Bild: 61 Konflikte weltweit, zehn davon Kriege. Österreich, so klein es ist, sei Teil dieser Welt. Hybridkriege – Cyberangriffe, Desinformation, Propaganda – seien keine Theorie, sondern Alltag. „Wir befinden uns faktisch schon in einem Konflikt“, sagt er, „wir wollen es nur nicht wahrhaben.“
Sein Credo heißt Resilienz: Familien sollen in der Lage sein, 14 Tage autark zu überleben. Gemeinden müssten Notfallpläne entwickeln, Infrastruktur schützen, Kommunikationswege sichern. „Jede Gemeinde ist ein Glied in der Kette Europa – und nur so stark wie das schwächste Glied.“
Zur Neutralität äußert er sich nüchtern. Österreich habe in den vergangenen Jahrzehnten überdurchschnittlich viele Soldaten im Auslandseinsatz gestellt, mehr als Deutschland. „Aber Neutralität darf nicht zum romantischen Wohlfühlbegriff werden“, sagt Bachmann. Im Angriffsfall sei sie ohnedies hinfällig.
Viele Bürgermeister nicken ernst. Es ist ein Vortrag ohne Trostpflaster – aber einer, der die Wirklichkeit zurechtrückt.
Staatssekretär Pröll: Europas digitale Abhängigkeit

Dann wechselt das Thema, aber nicht der Tonfall. Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, spricht über die „größte Disruption unserer Zeit“: Künstliche Intelligenz. „Wir sind abhängig – und Abhängigkeit ist gefährlich“, sagt er.
Seine Diagnose: Europa hat die Entwicklung verschlafen. Smartphones, Clouds, Algorithmen – alles kommt aus den USA oder China. „Wir sind digital kolonialisiert.“
Prölls Vision ist eine „Charta der digitalen Souveränität“, die bis Jahresende vorliegen soll. Sie ruht auf drei Säulen:
- Europäische Cloud-Infrastruktur, damit Daten nicht länger bei Amazon, Google oder Tencent liegen.
- Digitale Bildung – von der Volksschule bis zur Erwachsenenweiterbildung. „Wir müssen verstehen, wie diese Technologien funktionieren, sonst beherrschen sie uns.“
- ID Austria als zentrales Instrument für Vertrauen, Sicherheit und digitale Selbstbestimmung.
Pröll spricht mit Dringlichkeit, fast werbend. Er appelliert an die Bürgermeister, die Digitalisierung vor Ort voranzutreiben – als „erste Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger“. Europa könne nur souverän bleiben, wenn Gemeinden mitziehen.
Guttenberg: Zwischen Ironie und bitterem Ernst

Am Nachmittag betritt ein Mann die Bühne, der weiß, wie man Aufmerksamkeit bindet: Karl-Theodor zu Guttenberg. Er beginnt mit einem Scherz über die Deutsche Bahn: „Wenn Sie sie testen wollen, nehmen Sie Schnaps mit.“ Das Lachen im Saal ist laut, aber kurz – denn bald schlägt er ernste Töne an.
Über Donald Trump sagt er: „Er ist ein authentischer Drecksack.“ Das klingt derb, ist aber ernst gemeint. Gemeint ist: Populisten gewinnen, weil sie bei ihren Themen bleiben. „Die Mitteparteien in Europa hingegen wirken wie Getriebene, die den Populisten hinterherhecheln.“
Guttenberg seziert die Schwächen Europas: wirtschaftlich stark, politisch schwach. Schlüsseltechnologien wie KI, Plattformökonomie und digitale Infrastruktur seien verschlafen worden. „Wir sind zu sehr mit uns selbst beschäftigt – und zu wenig auf Augenhöhe mit den anderen.“
Seine Mahnung: Die Mitte müsse wieder proaktiv Themen setzen, nicht nur reagieren. Auch unangenehme Wahrheiten müssten angesprochen werden – Renten, Verteidigung, Neutralität. „Es reicht nicht, nur populär sein zu wollen. Politik muss führen, nicht folgen.“
Das Publikum schwankt zwischen Schmunzeln und Nachdenklichkeit. Guttenbergs Mischung aus Ironie und bitterem Ernst sitzt.
Katrin Steiner-Hämmerle: Demokratie braucht Regeln – und Räume
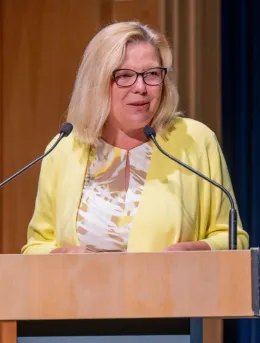
Zum Schluss gehört die Bühne Katrin Steiner-Hämmerle, Politikwissenschafterin aus Kärnten. Sie beginnt selbstironisch: „Heute bin ich die Quotenfrau.“ Dann wird sie ernst: „Wenn wir über Demografie reden, ohne Frauen zu erwähnen, ist das absurd. Ohne sie gibt es keine höheren Geburtenraten – und Migration betrifft sie ebenso.“
Ihr Vortrag ist ein Rundumschlag: Nur 15 Prozent der Weltbevölkerung leben in liberalen Demokratien – Tendenz sinkend. Auch in Europas Nachbarschaft, in Ungarn oder Serbien, sei Demokratie unter Druck. „Wir dürfen nicht glauben, dass sie unzerstörbar ist.“
Sie verteidigt den Wert von Regeln – gegen das gängige Schlagwort „Überregulierung“. „Regeln sind die Infrastruktur der Demokratie“, sagt sie. Sie schützen vor Willkür, sichern fairen Wettbewerb, schaffen Vertrauen. Aber: „Wenn Regeln zur Bürde werden, verlieren sie Akzeptanz.“
Zur EU fordert Steiner-Hämmerle mehr Handlungsfähigkeit: weg vom Einstimmigkeitsprinzip, Schutz kritischer Infrastruktur, mehr Eigenständigkeit bei Sicherheit und Digitalisierung. Und sie sagt: „Wir Österreicher haben eine Trittbrettfahrer-Mentalität. Werden wir angegriffen, sollen die Nachbarn helfen. Werden die Nachbarn angegriffen, geht uns das nichts an. Das kann nicht funktionieren.“
Die Diskussion: Neutralität, Populismus, Jugend
In der abschließenden Diskussion wird es hitzig. Guttenberg nennt die Neutralität einen „bequemen romantischen Begriff“. Bachmann hält fest, dass sie im Ernstfall ohnehin nicht greife. Steiner-Hämmerle fordert, die Debatte endlich offen zu führen – auch wenn 70 Prozent der Bevölkerung „Neutralität super“ finden.
Beim Thema Populismus herrscht Einigkeit: Die FPÖ setzt die Themen, die anderen reagieren. Guttenberg mahnt, die Mitte müsse lernen, eigene Narrative zu entwickeln. Steiner-Hämmerle ergänzt: „Populisten punkten nicht nur mit Inhalten, sondern mit Sprache und Framing. Demokraten dürfen diese Ebene nicht länger ignorieren.“
Ein Hoffnungsschimmer bleibt die Jugend. Bischof Glettler widerspricht dem Klischee, sie sei unpolitisch. „Sie suchen Sinn, sie haben eine hohe Sensibilität für Umwelt und Soziales. Man muss ihnen nur früher Verantwortung zutrauen.“
Am Ende der Sommergespräche
Zwei Tage Bad Aussee haben gezeigt: Gemeinden sind keine Zuschauer – sie stehen an der Frontlinie der Veränderung. Am ersten Tag ging es um die ganz konkreten Herausforderungen vor Ort: alternde Bevölkerung, pflegende Angehörige, leere Supermarktregale, Datenzentren als Stromfresser. Am zweiten Tag folgte der Blick hinaus in die Welt: geopolitische Spannungen, die Abhängigkeit von digitalen Konzernen, die Fragilität der Demokratie.
Gemeinsam ergibt das ein Bild, das klarer nicht sein könnte: Die großen globalen Fragen schlagen sich zuerst in den Gemeinden nieder. Dort entscheidet sich, ob Pflege organisiert, ob Demokratie gelebt, ob Resilienz aufgebaut wird.
Bad Aussee hat damit wieder bewiesen, dass Gemeinden nicht das Publikum sind, das der Weltpolitik zuschaut. Sie sind das Spielfeld, auf dem entschieden wird, ob Europa handlungsfähig bleibt – im Großen wie im Kleinen.











