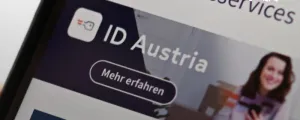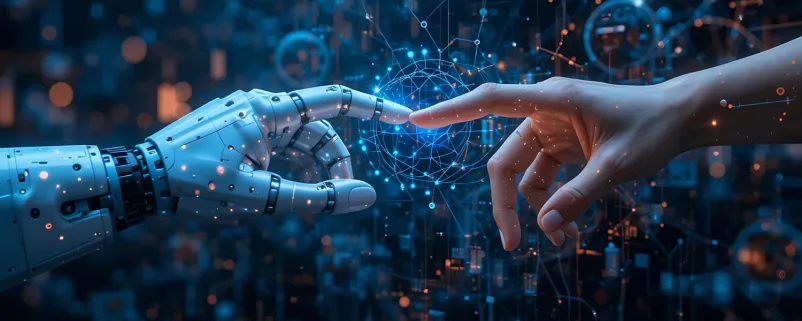
Viele unterschätzen die gewaltigen Umwälzungen durch KI – auch in der Kommunalverwaltung.
© ROni051 - stock.adobe.com generiert mit KI
Digitalisierung
„Die KI-Revolution ist mit der des Buchdrucks vergleichbar“
Michael Zimper, Geschäftsführer und Gesellschafter des Österreichischen Kommunal-Verlags, ist mit Kommunalpolitik aufgewachsen. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich mit Anwendungsfeldern künstlicher Intelligenz in Gemeinden. Er sieht gewaltige Chancen, aber auch Gefahren für die Gesellschaft. Gemeindechefs falle eine Schlüsselrolle zu.
Die meisten Menschen unterschätzen immer noch die Auswirkungen der KI“: Würden Sie dieser Aussage zustimmen?
Auf jeden Fall! Mir scheint, dass viele die neue Technologie noch mit einer weiteren Applikation im Bereich der Digitalisierung verwechseln. Sie glauben, im Großen und Ganzen bleibt alles gleich, nur dass es jetzt ein neues Werkzeug gibt. Aber das ist ein Irrtum. Die Digitalisierung hat eine neue Art der Speicherung und Weitergabe von Daten ermöglicht. Daten wurden verschnitten, nicht aber verändert. KI hingegen ist eine zusätzliche Intelligenz, die uns hilft, zu denken, Zusammenhänge zu erkennen und sogar Entscheidungen vorzubereiten.
Kann sie Gemeinden helfen, Geld zu sparen, sogar die Haushalte zu konsolidieren?
Nicht nur das. Die neue Technik kann die Kosten deutlich senken und außerdem dazu beitragen, die Qualität der Verwaltung stark zu verbessern. Und das, obwohl auf die Kommunen in den letzten Jahren eine enorme zusätzliche Aufgabenflut zugekommen ist, während in den nächsten Jahren eine große Pensionierungswelle ansteht.
Wir werden in Zukunft mit weniger Personal mehr leisten können. Das geht, wenn wir künstliche Intelligenz dazu nutzen, repetitive Aufgaben zu erledigen. Dann können wir uns mehr um die eigentlichen Aufgaben kümmern: entscheiden, gestalten. Das, warum die meisten Menschen eigentlich in die Gemeindepolitik gegangen sind. Das ist es im Übrigen auch, was die KI nicht machen sollte. Es braucht eine Demokratie mit Legitimation und Vernunft. Eine, die vieles repräsentiert. Das kann man nicht einfach der KI als Befehl reinklopfen.
Mehr und bessere Leistung bei viel geringeren Kosten also?
Ja. Ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass darin die größte Chance der neuen Technologie liegt. Künstliche Intelligenz kann Termine koordinieren, Bescheide vorbereiten oder Bürgeranfragen beantworten. Sie könnte grundsätzlich sogar selbstständig Entscheidungen treffen. Aber dazu muss sie genau erfahren, was ihre Aufgabe ist. Man muss wissen, wie man sie anleitet.

Man sollte als Bürgermeisterin oder Bürgermeister also grundsätzlich wissen, wie man einen präzisen Befehl an die KI – in der Fachsprache einen „Prompt“ – formuliert?
Ich denke, man sollte zumindest grundsätzlich wissen, wie man die künstliche Intelligenz richtig anleitet. Es geht ja vor allem darum, ihr zu sagen, was sie tun soll. Je besser man es erklärt, desto besser werden auch die Ergebnisse.
Bei vielen Anwendungen für Gemeinden gibt es noch Luft nach oben. Ich denke an KI-Telefonhotlines, die im breiten Wiener Dialekt sprechen. „Heast Oida“ kommt in Westösterreich bei der Bevölkerung nicht immer gut an.
Das stimmt nicht. Es gibt bereits Telefonstimmen, die etwa Tirolerisch sprechen. Es könnte sogar die Stimme des Bürgermeisters sein. In diesem Fall müsste es aber natürlich einen klaren Hinweis zu Beginn des Gesprächs geben. Sonst wäre das ethisch ein großes Problem.
Bleibt die Frage, ob derart ausgetüftelte KI-Anwendungen für eine kleine Gemeinde mit 1.500 Einwohnerinnen und Einwohnern überhaupt halbwegs erschwinglich sind.
Das ist weniger ein Aufwandsthema. Es geht da mehr um die Brainpower, die man hinein-steckt. Man muss die KI trainieren. Sie holt sich alle verfügbaren Informationen. Da stellt sich dann vor allem die Frage, wie man diese richtig limitiert, um zu verhindern, dass sie halluziniert.
Also Sachen erfindet. Es ist ein wenig so, wie wenn man in einer fremden Stadt wen nach dem Weg zum Gemeindeamt fragt. Der schickt einen einfach irgendwohin, weil er nicht zugeben will, dass er selbst null Ahnung hat.
Dieser Vergleich trifft es nicht ganz. Der Fehler bei Halluzinationen liegt in der Regel bei den Anwendern, die ihre Frage schlecht gestellt – oder gepromptet – haben. Um bei dem Beispiel zu bleiben: Irgendwann führt die Wegbeschreibung bestimmt zu einem Gemeindeamt, nur eben zu einem ganz anderen.
Im US-Bundesstaat Wyoming hat ein Mann für das Bürgermeisteramt einer Kleinstadt kandidiert, der alle Entscheidungen einer KI überlassen wollte. Keine gute Idee, oder?
Auch hier würde es auf den Prompt ankommen. Sage ich der KI: Triff alle Entscheidungen so, als wärst du ein demokratischer Bürgermeister? Oder ein republikanischer? Natürlich könnte man ihr sagen, sie soll Entscheidungen treffen, die die Mehrheit repräsentieren. Oder solche, die rein wissenschaftlich fundiert sind.
Das Versprechen lautete: die besten Entscheidungen für alle Bürgerinnen und Bürger.
Aber was ist die Entscheidungsgrundlage? Durch die Art der Fragestellung beeinflusse ich den Outcome. Und dann stellt sich noch die Frage, welche Informationen ich der KI zur Verfügung stelle. In der Schweiz bekommen die Menschen vor jedem Referendum ein Abstimmungsbüchlein mit allen wichtigen Argumenten für oder gegen eine bestimmte Entscheidung. In Großbritannien hieß es 2016 nur: „Sind Sie für den Verbleib in der EU oder für einen Brexit?“ Das ist eine komplett andere Fragestellung.
Eine KI-Entscheidung zur Politik ließe sich also durch den Prompt manipulieren?
Ja. Und es stellt sich dann schon die Frage, wer eigentlich bestimmt. Ist das dann noch eine Demokratie oder geben wir die Mitbestimmung perspektivisch irgendwann ab.
Trotzdem könnte man die Frage stellen, ob eine KI nicht mitunter vernünftiger entscheiden würde als der derzeitige US-Präsident.
Einspruch. Gerade die Trump-Regierung setzt besonders stark auf KI-gestützte Entscheidungen. Da gab es den bekannten Fall, wo von den USA ganz x-beliebige Zölle gegen andere Länder ausgerufen wurden …
… unter anderem 30 Prozent gegen die australischen Heard- und McDonald-Inseln, wo ausschließlich Pinguine leben.
Genau. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Höhe der jeweiligen Zölle mit KI bestimmt wurde. Und sie wurde schlecht gepromptet, weil man das Handelsbilanzdefizit mit den Zollrichtlinien verwechselt hat. Die Frage wird sein, was wir der KI prompten, sollte sie uns einmal tatsächlich übernehmen – wovor manche warnen. Wie soll sie dann die Menschen behandeln?
Diese bange Frage stellen sich insgeheim wohl gar nicht so wenige von uns.
Man könnte ihr sagen, dass sie das Glück der Menschen maximieren soll. Aber wie misst man Glück? Könnte es sein, dass sie uns Endorphine spritzt? Aber das geht hier wohl zu weit. Letztlich muss jeder für sich selbst die Frage nach dem richtigen Umgang mit der KI beantworten.
Lässt sich die KI eigentlich mit früheren technischen Revolutionen vergleichen? Mit der Einführung des Computers oder des Internets?
Wenn, dann wäre es wohl nur vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks…
… der unter anderem zum Dreißigjährigen Krieg geführt hat.
Oder zu den Hexenverbrennungen. Aber eben auch zur Entdeckung Amerikas und zur Aufklärung. Er hat auf jeden Fall zu enormen gesellschaftlichen Umwälzungen geführt.
Und zu einem Kontrollverlust. Viele Verwerfungen sieht man jetzt schon: Hass im Netz, Fake News, KI-Videos von echten Personen. Wie können Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hier Orientierung geben?
Wir werden in kürzester Zeit vielen Informationen im Internet nicht mehr trauen können. Man sieht jetzt schon täuschend echte Videos, wo der frühere Papst den Catwalk entlanggeht. Natürlich ist das ein Fake. Irgendwann werden selbst die Radikalsten den Glauben an die vielen Inhalte im Netz verlieren. Die Menschen werden sich zunehmend zurückziehen. Das kann Medienmarken stärken, die mit dem in sie gesetzten Vertrauen sorgsam umgehen. Und auch das Vertrauen in die regionale Politik wird viel wichtiger werden. Phasen des Umbruchs sind auch Phasen der Unsicherheit, wo Menschen Halt suchen.
Es wird Verlierer geben, wir werden mittelfristig auf eine höhere Arbeitslosigkeit zusteuern. Dagegen können die Gemeinden wenig machen. Aber sie können darauf achten, dass möglichst wenig Wissen über ihren Ort verloren geht. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind keine Seelsorger. Aber sie können Menschen ein Gefühl der Sicherheit und der Stabilität geben.
Dies könnten die Auswirkungen der KI-Revolution sein
Automatisierung. Lästige Aufgaben, die wenig Fachwissen benötigen, werden in den nächsten Jahren großteils an die KI ausgelagert werden. Kurzfristig ist mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechen. Es werden aber auch viele neue Berufsfelder für Fachkräfte entstehen.
Gesundheitsversorgung. KI kann zu besseren Diagnosen führen. Im Bereich der Arzneimittelforschung erwartet man große Fortschritte.
Transport. Man wird sich künftig an selbstfahrende Autos gewöhnen.
Umwelt & Klima. Richtig eingesetzt kann KI helfen, Ressourcen zu schonen, die Umwelt zu schützen und den Klimawandel in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zumindest entschiedener einzubremsen.
Gesellschaft. KI kann der Menschheit nutzen oder soziale Ungerechtigkeit verstärken. Entscheidend ist, wie vernünftig wir damit umgehen.