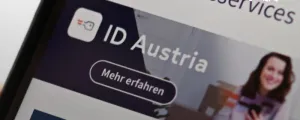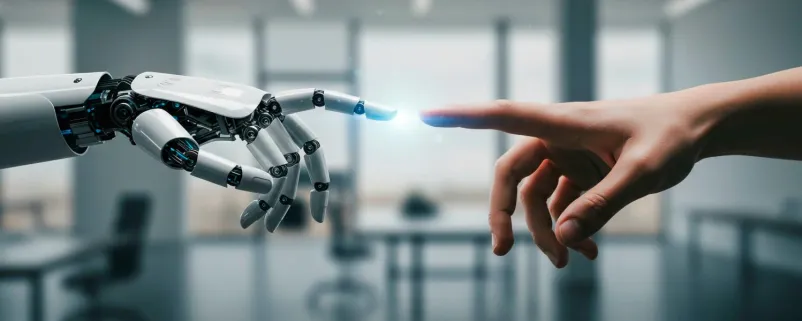
© Steffani - stock.adobe.com
Keine Science fiction
Die KI kommt ins Amt
Ob in der Verwaltung, im Bürgerservice oder in der Stadtplanung – Künstliche Intelligenz bietet Gemeinden ganz neue Werkzeuge, um effizienter, bürgernäher und vorausschauender zu arbeiten. Doch mit den neuen Möglichkeiten wachsen auch die Fragen nach Verantwortung, Transparenz und ethischer Ausrichtung. Wie können Kommunen KI sinnvoll nutzen, ohne den Menschen aus dem Blick zu verlieren?
In Österreich – wie in vielen anderen Ländern – steht fest: Künstliche Intelligenz wird kommen, und sie wird bleiben. Sie wird unsere Art zu arbeiten, zu verwalten, zu planen und zu kommunizieren verändern. Gerade auf kommunaler Ebene eröffnet sie neue Chancen: in der Verwaltung, im Bürgerservice, in der Verkehrssteuerung oder bei der Stadtentwicklung. KI kann helfen, Aufgaben effizienter zu erledigen und Ressourcen besser zu nutzen. Doch mit den technologischen Möglichkeiten wachsen auch die Fragen nach ethischer Verantwortung, Kontrolle und Sinnhaftigkeit.
KI in der kommunalen Praxis: Chancen für den öffentlichen Raum
Für kommunale Entscheidungsträger stellen sich ganz praktische Fragen: Wo kann KI konkret helfen? Und: Wie kommt man überhaupt zu einer vertrauenswürdigen, sinnvollen Lösung?
Tatsächlich sind die Einsatzfelder vielfältig und oft niederschwellig umsetzbar:
- Bürgerservice: KI-gestützte Chatbots können rund um die Uhr Informationen zu Öffnungszeiten, Formularen oder Anträgen bereitstellen – in mehreren Sprachen und barrierefrei.
- Verwaltungsautomatisierung: KI kann dabei helfen, Anträge zu prüfen, Termine zu koordinieren oder wiederkehrende Verwaltungsvorgänge zu beschleunigen.
- Infrastruktur-Management: Bei der Analyse von Verkehrsflüssen, Energieverbräuchen oder Müllabfuhrdaten liefert KI wertvolle Prognosen oder Instandhaltungszyklen,
- Partizipation und Bürgerdialog: Sentiment-Analysen von Bürgerfeedback oder automatisierte Auswertungen von Umfragen helfen, Anliegen früher zu erkennen.
Viele dieser Anwendungen existieren bereits als Open-Source-Lösungen oder als Dienste spezialisierter Anbieter. Kommunen können über Förderprogramme, Smart-City-Initiativen oder interkommunale Plattformen Zugang zu erprobten Tools erhalten – vorausgesetzt, sie verfügen über digitales Know-how und klare ethische Leitlinien.
Gerade hier können Kommunalpolitiker:innen als Multiplikatoren wirken: durch Aufklärung, Rahmengebung und konkrete Pilotprojekte, die zeigen, dass KI sinnvoll, menschenzentriert und gemeinwohlorientiert eingesetzt werden kann.
Zwischen Neugier und Sorge: Die Ängste sind nicht unbegründet
Trotz dieser Chancen gibt es eine spürbare Unsicherheit in der Bevölkerung. Die Angst, dass Maschinen Menschen ersetzen. Die Sorge, dass Entscheidungen „intransparent“ oder „unmenschlich“ werden. Oder der Verdacht, dass Technik zum Selbstzweck verkommt – ohne Rücksicht auf Gerechtigkeit, Datenschutz oder demokratische Kontrolle.
Diese Ängste sind nicht irrational. Schon heute zeigt sich, dass KI Vorurteile aus Trainingsdaten übernehmen kann. Dass sie Entscheidungen trifft, die für Menschen nicht mehr nachvollziehbar sind. Und dass Systeme so komplex werden, dass auch ihre Entwickler\:innen nicht mehr jeden Schritt erklären können.
Versuche, KI „sicher“ zu machen – und ihre Grenzen. Seit Jahrzehnten wird versucht, Maschinen ethische Grenzen zu setzen. Die drei „Robotergesetze von Isaac Asimov“ lauten:
- Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen.
- Er muss den Befehlen von Menschen folgen – es sei denn, sie würden jemanden verletzen.
- Er muss sich selbst schützen – solange er dabei niemanden verletzt.
Was in der Literatur funktioniert, ist in der Praxis hochkomplex. Moderne KI „versteht“ keine Ethik – sie rechnet, erkennt Muster und optimiert Ziele. Deshalb braucht es Regeln, die von außen wirken: Datenschutzrichtlinien, Prüfkataloge für faire KI, gesetzliche Verbote von Diskriminierung oder intransparenten Entscheidungen.
Europa geht hier mit dem „EU AI Act“ voran, Österreich mit klaren Vorgaben für Datenschutz und Gemeinwohlorientierung. Doch Regulierung allein genügt nicht. Es braucht auch ethische Reflexion, politische Kontrolle und – ganz wichtig – den Mut, Verantwortung nicht an Maschinen zu delegieren.
Die Realität: Was technisch möglich ist, wird (meist) auch gemacht
Ein kritischer Blick in die Welt zeigt: KI wird längst auch für Überwachung, Manipulation oder sogar Krieg eingesetzt. Autonome Drohnen, KI-gesteuerte Waffensysteme, soziale Scoring-Systeme in autoritären Staaten – all das ist Realität. Und sie zeigt: Nicht alles, was machbar ist, ist auch wünschenswert.
Gerade deshalb braucht es auf kommunaler Ebene ein Gegengewicht: eine bewusste, menschlich geprägte KI-Nutzung. Eine, die nicht Effizienz über alles stellt, sondern das Gemeinwohl ins Zentrum rückt. Eine, die die Würde der Menschen achtet, statt sie in Datensätze zu zerlegen.
Und jetzt? Verantwortung übernehmen – Chancen gestalten
Gemeinden sind nahe am Menschen. Sie wissen, wo Hilfe gebraucht wird. Sie kennen die Probleme und Chancen vor Ort. Deshalb sind sie prädestiniert, KI nicht nur „einzusetzen“, sondern aktiv zu gestalten:
- durch Pilotprojekte mit klaren ethischen Leitlinien,
- durch transparente Kommunikation mit der Bevölkerung,
- durch Weiterbildung in Verwaltung und Politik,
- durch Kooperation mit Forschung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft.
Die Zukunft der KI in Österreichs Gemeinden entscheidet sich nicht in Serverzentren oder Gesetzen allein. Sondern dort, wo Technik auf Lebensrealität trifft: Im Gemeindeamt, in der Bürgerbeteiligung, im Dialog zwischen Menschen.
Was sind „Asimovs Gesetze“?
Die drei Robotergesetze von Isaac Asimov wurden in den 1940er Jahren formuliert und gehören zu den bekanntesten fiktionalen Regeln für das Verhalten künstlicher Intelligenz (KI) und Roboter.
Sind die Gesetze anwendbar?
Nur sehr eingeschränkt. Die Robotergesetze wurden als literarisches Konzept geschaffen, um ethische und philosophische Dilemmata zu thematisieren – nicht als konkrete technische Vorgaben. Dennoch beeinflussen sie die Debatte über KI-Ethik stark.
Indirekt werden sie jedoch in Form moderner Prinzipien angewendet:
- Asilomar AI Principles, OECD AI Principles, EU AI Act oder die Ethikrichtlinien der High-Level Expert Group on AI der EU greifen ähnliche Grundwerte auf: Schadensvermeidung, Transparenz, Verantwortung, Rechenschaft.
- Sicherheitsforschung in der KI (AI Safety), etwa bei OpenAI, DeepMind oder Anthropic, berücksichtigt ähnliche Zielsetzungen: Vermeidung unbeabsichtigter Schäden, Kontrolle durch Menschen, Priorisierung menschlicher Werte.
- In der Robotik, z. B. bei Pflege- oder Assistenzrobotern, sind Sicherheitssysteme Pflicht – etwa durch Notabschaltungen, Hinderniserkennung oder automatische Stopps. Das entspricht gewissermaßen dem ersten Gesetz.