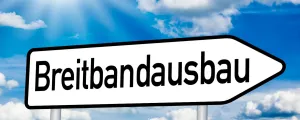Dr. Artur Wechselberger sprach in seiner Keynote am KWF 2024 über die Zukunft der medizinischen Versorgung.
© Jörg Christandl
Appell an Gemeinden
Zukunft der ambulanten medizinischen Versorgung
Kommunen versuchen seit Jahren die ambulante medizische Versorgung sicherzustellen. Dr. Artur Wechselberger zeigte am Kommunalwirtschaftsforum 2024, mit seiner Keynote „Die Zukunft der ambulanten medizinischen Versorgung. Neue Aufgaben für Kommunen. Folgt Geld Leistung?“ welche Herausforderungen auf dem Weg zu einer flächendeckenden medizischen Versorgung aus Sicht der Ärzte zu meistern sind.
Mit zwei anschaulichen Beispielen aus seiner Heimat Tirol zeigte der Allgemeinmediziner, wie es ist, wenn es mit der lokalen und regionalen medizinischen Versorgung nicht mehr funktioniert. Erstes Beispiel: Das Kaiserjubiläum Krankenhaus in Wörgl wurde vor 20 Jahren geschlossen, nachdem in Kufstein ein großes überregionales Krankenhaus errichtet wurde. Mit der Schließung des Hauses in Wörgl sah sich die Gemeinde vor der Aufgabe, die örtliche Versorgung sicherzustellen. Man hat ein Ärztehaus initiiert, eine Tagesklinik mit Ambulanz und einen permanent erreichbaren ärztlichen Dienst mit angeschlossenem Sanatorium finanziert und somit etabliert. Aus Wechselbergers Sicht eine gute Sache.
Initiative von Telfs zur Sicherung der Versorgung
Am Beispiel von Telfs, einer Gemeinde westlich von Innsbruck, zeigt er das Dilemma vieler österreichischer Gemeinden. Denn das nächste Bezirkskrankenhaus liegt im Osten von Innsbruck und damit sei es laut Wechselberger problematisch mit der Krankenhausversorgung der Menschen, die westlich von Innsbruck leben. Das Problem wurde gelöst mit drei Ärztehäusern auf einem Grundstück, das die Gemeinde damals zur Verfügung gestellt hat.
Und hier setzt Wechselbergers Kritik an: Bei der Planung von Gesundheitseinrichtungen seien die Gemeinden nicht dabei. Und das ist eine der großen Schwächen der Struktur in Österreich. Geplant wird von den drei Säulen „Heiligem Bund, Ländern und Sozialversicherungen“, wie Wechselberger erläutert. Und was hier geplant werde, werde auch umgesetzt. Oder wenn nicht, dann müssen sich die Gemeinden drum kümmern, dass die Versorgung funktioniert. Über diese Planung gehe natürlich auch die Finanzierung und die Finanzausgleichs-verhandlungen.
Leise Kritik übt der Arzt an den verzweigten Strukturen, die man braucht, um ein regionales, lokales und überregionales Gesundheitsversorgungs-System aufrecht zu erhalten. Von Rehaeinrichtungen über Akutkrankenhäuser, Krankenhäuser, Ambulanzen bis hin zu selbständigen Ambulatorien müsse man sprechen, wenn man die Zuständigkeiten und die Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden betrachtet.
Gemeinden können, wenn ihnen ein Arzt oder eine Ärztin fehlt, selbst Aktivitäten setzen. „Das wird dann auch in der Planung berücksichtigt, aber mitzureden haben sie nichts“, erklärt Wechselberger. Man habe sich zwar die Stärkung der ambulanten Versorgung bei gleichzeitiger Entlastung des akut-stationären Bereich und die Optimierung des Ressourceneinsatzes in den Ziel-Steuerungsvertrag geschrieben, aber wie das System eigentlich finanziert wird, sei nicht optimal geregelt.
Gemeinden an Finanzierung beteiligt
Wie werden die Krankenhäuser finanziert? Gemeinden seien zwar nicht der große Teil der Finanzierer, aber es sind immerhin 1,5 Milliarden Euro pro Jahr, die die Gemeinden in die Finanzierung der Krankenhäuser hineinstecken. „Nur mitzureden haben sie nicht“, stellt Wechselberger klar.
Wenn keine medizinische Versorgungseinrichtung im niedergelassenen Bereich in der Nähe ist, weichen die Menschen auf Krankenhaus-Ambulanzen aus.
Der Status Quo der Gesundheitsreform vor einigen Monaten sei, dass man jetzt auch sage: digital vor ambulant und stationär, ambulant vor stationär. Gelder wurden ausgeschüttet zur Stärkung des niedergelassenen Bereiches. Krankenhäuser sollen 600 Millionen und der niedergelassene Bereich 300 Millionen bekommen. Dabei sei der fehlende Ausbau und die Weiterentwicklung des Kassenbereiches im niedergelassenen Bereich ein großes Problem. Der Bereich der Wahlärzte sei in den letzten Jahren rasant gestiegen. Auch Krankenhausambulanzen werden häufig aufgesucht. Die Stagnation im Sozialversicherungsbereich, im niedergelassenen Versorgungsbereich, sprich in der Kassenmedizin, hat nur deshalb keine großen Versorgungslücken geschaffen, weil die Krankenhausambulanzen dies aufgefangen haben und weil es die Wahlärzte gibt.
Das System bewege sich nicht nur wegen der Demographie in eine Krise. Es wird künftig einen Mehrbedarf an Pflege geben, das sei laut Wechselberger schon jetzt die gelebte Realität. „Wir brauchen 30 % mehr mobile Dienste allein bis 2030 und über 30 % mehr stationäre, krankenhausgebundene Pflege. Da brennt der Hut“, appelliert er.
Teilzeit Arbeit erschwert die Versorgung
Im Pflegeberuf, aber auch im Arztberuf entscheiden sich immer mehr Menschen für Teilzeit-Arbeit. Das Problem ist, dass auf der einen Seite der Bedarf unheimlich steigt aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung, auf der anderen Seite aber die zur Verfügung stehende Arbeitskraft abnimmt. Hier ergibt sich das Problem, das zu lösen ist.
Es werde künftig einen starken Konkurrenzkampf um die Fachärzte geben. Fachärzte gibt es nicht zu viele, und jenen ist eine ausgewogene Work-Life Balance ebenso wichtig, wie dem Rest der Bevölkerung. Hier könne man mit Zusammenschlüssen trotzdem die fachärztliche Versorgung sichern. In Konkurrenz zum Krankenhaus steht man genauso wie mit Wahlärzten.
Ganz wichtig sei die Infrastruktur. Ärzte sind Ärztinnen und Ärzte. Diese seien keine Unternehmer, die Großunternehmen oder Mittelunternehmen aufbauen. „Deswegen haben wir so viele Praxen, weil die Praxisgröße genau dem entspricht, was eine Ärztin oder ein Arzt zu leisten schafft neben seiner medizinischen Tätigkeit“, erklärt Wechselberger. Und hier wünscht sich der Arzt Unterstützung der Gemeinden und das diese Infrastruktur bereitstellen, nicht nur für kleine Praxen, sondern auch für größere Einheiten. Er fordert Hilfestellung und Entlastung von administrativen Aufgaben, Hilfe beim Schnittstellenmanagement. Am Beispiel Wörgl zeigt Wechselberger abschließend auf, wie Kassenärzte in den Ort gelockt werden sollen. So setzt man in der Gemeinde auf: gezielte Förderung von Turnusärzten, Hilfe bei der Immobiliensuche, Kinderbetreuung, Ordinationsumbau, Investitionsunterstützung, Mitarbeiterförderungen, Mietkostenzuschuss, Stärkung der ärztlichen Hausapotheke zum Beispiel.
„Medizinische Versorgung ist nicht nur Gesundheitsversorgung. Das alles leisten Gemeinden müssen sich viel mehr in diesem Bereich engagieren. Ich weiß, es ist eine gewaltige Herausforderung. Sie werden sie meistern, weil sie gemeistert werden muss“, schließt Wechselberger seine Keynote.