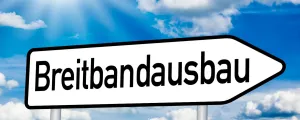Manfred Koblmüller (SIR Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen), Rechtsanwalt Rudolf Benedikter, Prof. Gernot Stöglehner (Institut für Raumplanung und ländliche Neuordnung (RUB) der Universität für Bodenkultur), Christine Schwaberger (Steiermärkische Landesregierung), Andrea Teschinegg (Steiermärkische Landesregierung), Gerald Fuxjäger (Präsident der ZiviltechnikerInnenkammer für Steiermark und Kärnten), Landtagsabgeordneter Karl Petinger, Michael Leitgeb (Städtebund), Moderator Reinhard Seiss .Foto: Jorj Konstantinov
Wege zur Energieraumplanung
Ein erheblicher Teil des vermeidbaren regionalen Energieverbrauches entsteht aus Gründen, die man leicht übersieht. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Raumplanung. Bei einer Tagung des Landes Steiermark und der Kammer der Ziviltechniker berieten Experten und Politiker über mögliche Konsequenzen und Lehren für die Raumplanungspolitik.
Siedlungs- und Städteplanung, Baugesetzgebung, Flächenwidmungspolitik, verkehrspolitische Maßnahmen und Konzepte und der damit in Verbindung stehende Behördenvollzug: Das sind kommunizierende Gefäße, die je nach Einsatz dramatisch nachteilige, aber umgekehrt auch äußerst positive Auswirkungen auf die Energiebilanz einer Region haben können.
Über die wesentlichen Faktoren, die den Energieverbrauch einer Region beeinflussen, sind sich die meisten Expertinnen und Experten weitgehend einig: Zersiedelung, praktisch nur mit dem PKW erreichbare Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten, große Distanzen zwischen Wohn- und Arbeitsplatz und nicht ausreichend attraktive Angebote des öffentlichen Verkehrs sind nur einige davon. Auch die wirtschaftlich sinnvolle Kaskadennutzung regionaler Energiequellen und die energieeffiziente Ausrichtung und Gestaltung der Gebäudesubstanz einer Region spielt dabei eine Rolle.
Eine wichtige Funktion nehmen dabei die Gemeinden ein. Denn aus der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanungspolitik ergeben sich weitreichende Folgen für alle anderen Planungsbereiche.
Gernot Stöglehner von der Universität für Bodenkultur in Wien, der das Thema vor allem mit Fokus auf den ländlichen Raum untersucht, sieht einen wichtigen Ansatz vor allem in der abgestimmten Planung von zwei Handlungsfeldern: Zum Einen in der zielgerichteten Steuerung und Freihaltung von Räumen für die Gewinnung und Speicherung unterschiedlicher erneuerbarer Energien und zum Anderen in der stärkeren Verdichtung der besiedelten Strukturen auch im ländlichen Raum.
Planungsaktivitäten besser abstimmen
Aus der Sicht von Manfred Koblmüller vom Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen liegt ein wesentlichen Ansatz zur Verbesserung im Spannungsfeld zwischen Energieerzeugung und Energienutzung in einer besseren Abstimmung der Planungsaktivitäten der unterschiedlichen Leistungsträger: Von den unterschiedlichen Energieversorgern, die oft in einem Binnenwettbewerb zueinander stehen, über kleine Gemeinden im Umland größerer Ballungsräume, bis hin zu den Städten in den Zentren der Ballungsräume wird hier noch viel zu wenig abgestimmt vorgegangen.
Bozen: Masterplan für nachhaltige Energienutzung
Ein Beispiel für geeignete öffentliche Steuerungsinstrumente präsentierte Rudolf Benedikter, der den Masterplan der Stadt Bozen für nachhaltige Energienutzung im Rahmen der Südtiroler Raumplanung vorgestellt hat. Eines der in diesem Rahmen derzeit laufenden Projekte ist die Erbauung eines neuen Fernwärmenetzes für Bozen, das von der Müllverbrennungsanlage gespeist wird und die Umsetzung eines neuen, nachhaltigen Stadtteils am Areal des Zugbahnhofes.
Aussagekräftige Vergleichskennzahlen sind wichtig
Christine Schwaberger von der Abteilung für Umwelt und Raumplanung der steiermärkischen Landesregierung hat bei der Vorstellung des EU-Projektes „SPECIAL – Implementierung nachhaltiger Energielösungen“ unter anderem die Bedeutung der Entwicklung und Bereitstellung aussagekräftiger Vergleichskennzahlen für eine energieeffiziente Raumplanung unterstrichen.
Bei der abschließenden Diskussion waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitgehend darüber einig, dass eine stärkere rechtliche Verankerung konkreter Energiebilanz-relevanter Punkte auch in der Raumordnungsgesetzgebung notwendig ist.