
Wo gebaut wird, sind oft auch öffentliche Gelder im Spiel – und damit das Bundesvergabegesetz (BVergG). Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist eine transparente, faire und gesetzeskonforme Vergabepraxis wichtiger denn je.
© stock.adobe.com – Andrey Popov
Vergabe-Compliance: Pflicht und Risiko für Auftraggeber und Bieter
Die öffentliche Beschaffung ist komplexer denn je – für Gemeinden wie für Unternehmen. Fehler bei Direktvergaben, unklare Eignungsprüfungen oder Nachlässigkeiten bei geförderten Projekten können nicht nur Förderungen kosten, sondern auch strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Saubere Vergabeprozesse sind damit für beide Seiten überlebenswichtig.
Immer dann, wenn Gemeinden am Markt bestimmte Leistungen gegen Entgelt einkaufen, haben sie als sogenannte „öffentliche Auftraggeber“ die Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes („BVergG“) einzuhalten. Insbesondere in den aktuellen Zeiten, in der Wirtschaft und öffentliche Hand vor besonderen Herausforderungen stehen, ist eine „saubere“ Vergabekultur wichtiger denn je.
Die Einhaltung der vergaberechtlichen Grundsätze Transparenz, Bietergleichbehandlung und Gewährleistung eines fairen und lauteren Wettbewerbs ist dabei nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern als Imagefrage auch längst in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit angekommen.
Die Vergabe-Compliance als zusammenfassender Begriff verschiedener Pflichten im Rahmen der öffentlichen Beschaffung zielt auf die Einhaltung dieser Grundsätze ab. Die Abwicklung von und Teilnahme an Vergabeverfahren hat sich dabei in den letzten Jahren stark verkompliziert, denn es gilt dabei nicht nur die Kernbestimmungen des BVergG, sondern auch eine immer größer werdende Anzahl an zusätzlichen Rechtsnormen einzuhalten, die sich teilweise aus Rechtsakten der EU, aber auch aus dem Kartell- und Strafrecht ergeben.
Aus Sicht der Vergabe-Compliance sind es aktuell vor allem die folgenden Aspekte, die besondere Gefahrenstellen beinhalten und in der Praxis häufig sowohl für Gemeinden als auch die Bieterseite zu rechtlichen Problem führen.
Achtung bei der Abwicklung von Direktvergaben
Direktvergaben sind in der Praxis insbesondere bei Gemeinden ein sehr beliebtes Instrument, um Aufträge mit niedrigen Auftragswerten zu vergeben. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass es sich bei Direktvergaben um keinen gänzlich „regellosen“ Vorgang handelt, sondern sich aus den §§ 46 ff BVergG diverse Pflichten ergeben, die dabei einzuhalten sind.
Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Ermittlung des geschätzten Auftragswerts an Hand der Grundsätze des BVergG vorgenommen und vor allem auch entsprechend dokumentiert wird – ein künstliches „Splitting“ von Aufträgen mit dem Zweck, den für die Direktvergabe zulässigen Schwellenwert nicht zu überschreiten, ist dabei jedenfalls rechtswidrig!
Weiters ist (besonders für die Bieterseite) relevant, dass der OGH in der Entscheidung 13 Os 93/23k klargestellt hat, dass Bieterabsprachen auch dann nach § 168b StGB strafbar sein können, wenn sie im Rahmen von Direktvergaben stattfinden (dies trotz des Umstands, dass das BVergG bei Direktvergaben keinen zwingenden Wettbewerb vorsieht). Potenziell strafbare Absprachen müssen dabei nicht zwangsläufig ausdrücklich stattfinden, sondern kann bereits ein konkludent aufeinander abgestimmtes Verhalten zwischen zwei (oder mehreren) Bietern die Grenze zur Strafbarkeit überschreiten (wie z. B. das koordinierte „Zurückstehen“ von Angebotsabgaben).
Fallstrick Eignungsprüfung / Selbstreinigung
Nach den Grundsätzen des BVergG dürfen öffentliche Aufträge nur an „geeignete“ Unternehmen vergeben werden. Unternehmen, welche die erforderliche Eignung nicht nachweisen können, sind (grundsätzlich zwingend) von der Teilnahme an Vergabeverfahren auszuschließen. Gemeinden haben zur Feststellung der Eignung eine entsprechende Eignungsprüfung durchzuführen, im Rahmen derer unter anderem das (Nicht-)Vorliegen von Ausschlussgründen zu prüfen ist.
In der Praxis beschäftigen in diesem Zusammenhang aktuell vor allem die Nachwirkungen des „Baukartells“ die Vergabepraxis, denn es stellt einen vergaberechtlichen Ausschlussgrund dar, wenn ein öffentlicher Auftraggeber über „hinreichend plausible Anhaltspunkte“ darüber verfügt, dass ein Bieter in wettbewerbsverzerrende oder nachteilige Abreden involviert war. Gemeinden stehen dabei vor der Situation, dass zahlreiche Bauunternehmen, die sich für die Vergabe von kommunalen Bauprojekten bewerben, aufgrund ihrer Involvierung in das Baukartell entweder eine rechtskräftige (kartellgerichtliche) Verurteilung aufweisen oder gegen diese zumindest (straf- und/oder kartellgerichtlich) ermittelt wird.
So stellt sich dabei die Frage, wann Gemeinden von einem entsprechenden „hinreichend plausiblen Anhaltspunkt“ für Kartellabsprachen auszugehen haben (und damit die Pflicht für Gemeinden zur Annahme des Ausschlussgrundes ausgelöst wird). Das Landesverwaltungsgericht Wien hat dazu im September 2024 mittlerweile klarstellend festgehalten, dass die bloße Eröffnung eines Strafverfahrens aufgrund der Unschuldsvermutung noch nicht als auslösenden Ereignis ausreicht. Vielmehr bedarf es für die Annahme des Ausschlussgrunds „gesicherter und belastbarer Erkenntnisse“3, wie dies etwa bei Abgabe eines Anerkenntnisses des betroffenen Unternehmens gegenüber der Bundeswettbewerbsbehörde der Fall ist.
Ist ein vergaberechtlicher Ausschlussgrund grundsätzlich erfüllt, darf der betroffene Bieter nicht automatisch von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, sondern muss ihm die Gelegenheit zur sogenannten „Selbstreinigung“ gegeben werden. In Kartellabsprachen involvierte Bieterunternehmen können durch den Nachweis entsprechender Selbstreinigungsmaßnahmen somit weiterhin an Vergabeverfahren teilnehmen, sofern sie glaubhaft machen können, dass sie trotz Verwirklichung des Ausschlussgrundes „zuverlässig“ sind.
Das BVergG sieht dabei strenge Voraussetzungen für eine erfolgreiche Selbstreinigung vor, deren erforderliches Ausmaß in der Praxis teilweise umstritten ist. Für eine erfolgreiche Selbstreinigung ist unter anderem die „aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden an der Klärung aller Tatsachen und Umstände betreffend die Straftat oder Verfehlung“ erforderlich, was in einem gewissen Spannungsverhältnis zum strafrechtlichen Selbstbelastungsverbot steht.
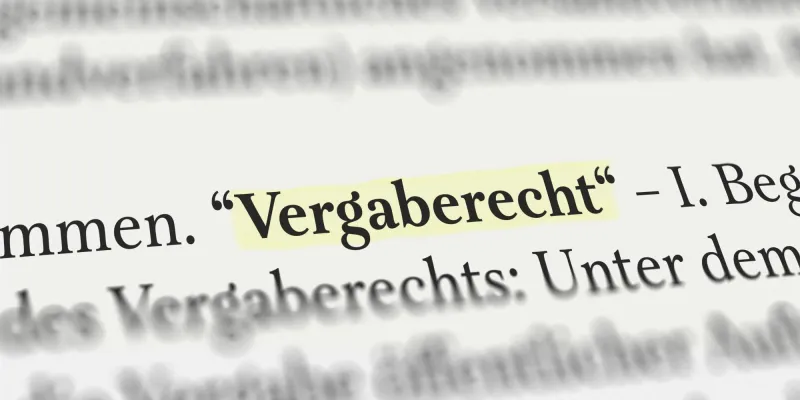
Zudem ist der Nachweis erforderlich, dass vom betroffenen Unternehmen ein Ausgleich für „jeglichen“ durch die Verfehlung verursachten Schaden geleistet wurde bzw. es sich zu einem solchen Ausgleich verpflichtet hat. Insbesondere für Gemeinden ist dies mit einem erheblichen Prüfaufwand und Nachweisschwierigkeiten verbunden, zumal der aus der Teilnahme an einem Kartell entstandene Schaden in der Praxis oft schwer bezifferbar ist.
Betroffenen Bieterunternehmen ist jedenfalls zu empfehlen, ihre Selbstreinigungsnachweise aktuell und parat zu halten. Gemeinden ist wiederum in diesem Zusammenhang zu empfehlen, die durchgeführte Eignungsprüfung möglichst detailliert zu dokumentieren und für den Fall, dass eine Selbstreinigung eines Bieters erforderlich ist, die angenommenen Gründe für die Erfüllung der einzelnen Voraussetzungen festzuhalten.
Vergaberecht bei geförderten Projekten beachten
Häufig beziehen Gemeinden Förderungen von dritter Seite für die Bereitstellung diverser (Dienst-)Leistungen oder die Errichtung von kommunaler Infrastruktur.
Sofern die Gemeinde in der Folge mit einem externen Dienstleister ein entgeltliches Vertragsverhältnis zur Umsetzung des Projekts eingeht und diesen – sei es auch mit geförderten Mitteln – bezahlt, liegt ein Vorgang vor, der nach den Bestimmungen des BVergG eine Ausschreibungspflicht in Bezug auf dieses Vertragsverhältnis auslösen kann.
In der Praxis wird dies von Gemeinden teilweise übersehen, was wiederum nach den Bestimmungen der meisten Förderprojekte den Entzug der Förderung nach sich ziehen kann. Dabei sehen viele Förderbestimmungen (insbesondere von EU-geförderten Projekten) besonders strenge Maßstäbe an die Einhaltung von Vergaberecht vor. Auch in diesem Zusammenhang ist vor allem eine lückenlose Dokumentation aller vergaberelevanten Entscheidungen ein wichtiges Mittel, um im Fall einer Förderprüfung die Einhaltung aller relevanten Bestimmungen nachweisen und den Verlust der Förderung verhindern zu können.
Alle drei Beispiele verdeutlichen, wie wichtig es für Gemeinden ist, im Zusammenhang mit Vergaben transparent zu agieren und alle wesentlichen Umstände entsprechend zu dokumentieren – eine Verpflichtung, die insbesondere auch durch das am 1. 9. 2025 in Kraft tretende Informationsfreiheitsgesetz immer wichtiger wird. Vergabe-Compliance ist somit gekommen, um zu bleiben.










