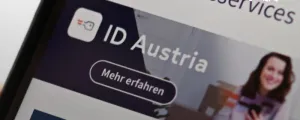Thomas Gremsl : „KI für den Menschen – und nicht statt des Menschen.“
© Jürg Christandl
Digitalisierung
Ethische Aspekte von KI und Digitalisierung
Digitalisierungsmaßnahmen im Gemeindeamt, der Einsatz von Chatbots zur Bearbeitung von Bürgeranfragen, die Nutzung von KI in unzähligen Lebensbereichen, all das erfolgt in rasantem Tempo und ist nicht mehr aus dem täglichen Arbeitsalltag wegzudenkken. Der Umgang mit KI darf jedoch nicht unkritisch passieren, dies betonte der Sozialetiker Thomas Gremsl beim Kommunalwirtschaftsforum 2025 in Saalfelden. Denn Digitalisierung ist mehr als nur technischer Fortschritt.
Die digitale Transformation wird von Expertinnen wie Thomas Gremsl nicht bloß als eine neue technologische Entwicklung, sondern als ein Epochenbruch, wie einstmals die Industrialisierung betrachtet – eine tiefgreifende, „menschheitshistorische Disruption“. Ähnlich wie frühere gesellschaftliche Revolutionen verändert sie unsere Lebenswelt, doch dismal in noch nie dagewesenem, rasantem Tempo – und die Entstehung und Nutzung digitaler Tools betrifft uns alle zugleich, unmittelbar und unumkehrbar.
Während frühere Veränderungen über Jahrzehnte hinweg in die Gesellschaft einsickerten, erleben wir heute eine dramatische Beschleunigung. Innovationen – von ChatGPT bis Instagram Threads – tauchen scheinbar über Nacht auf und beeinflussen unser Leben, ohne dass wir als Gesellschaft eine bewusste Entscheidung darüber treffen. Diese Dynamik darf jedoch nicht als Naturgewalt verstanden werden, appelliert Gremsl. Digitalisierung ist menschengemacht – und damit gestaltbar.
Warum Ethik jetzt besonders gefragt ist
Die ethische Betrachtung der technologischen Entwicklung wird oft als bremsende Moralinstanz empfunden, den gerade Wirtschaft und Politik sind wichtige Treiber der Entwicklung, Doch Ethik – insbesondere Sozial- und Technikethik – verfolgt vielmehr das Ziel, Orientierung zu bieten. Es muss die Frage gestellt werden: “Wie können wir in einer digitalisierten Welt gerecht, solidarisch und verantwortungsvoll leben?”, gibt Gremsl zu bedenken.
In der Betrachtung der Tools, die täglich in das Tun der Menschen integriert wird, eröffnet Ethik Perspektiven, statt sie zu schließen. Sie fragt nicht nach der „einen richtigen“ Antwort, sondern unterstützt Abwägungsprozesse. Gerade angesichts monopolistischer Machtstrukturen großer Technologiekonzerne bietet sie kritische Instrumente, um Verantwortung einzufordern – auf individueller wie struktureller Ebene.
KI: Vom Mythos zur Realität
Künstliche Intelligenz (KI) wird häufig als Superintelligenz missverstanden – dabei handelt es sich oft schlicht um datenbasierte Systeme, die durch das Schema Wahrnehmen – Interpretieren – Schlussfolgern – Entscheiden agieren. Solche Systeme können gewaltige Vorteile bringen, etwa durch automatisierte Verwaltung, aber sie bergen auch Risiken: Datenverzerrungen, diskriminierende Algorithmen oder den Verlust an menschlicher Autonomie. So zeige bereits die ausschließliche Nutzung von KI für Texterstellung eine Einbuße an Fähigkeiten der Personen, die dies tun. Auch der Verlust von Authentizität sei nicht zu unterschätzen, wenn man der KI das Verfassen von Emails überlasse, so Gremsl.
Hinzu kommen energieintensive Prozesse – paradoxerweise setzt die Tech-Industrie nun selbst auf Atomkraft, um ihren steigenden Energiebedarf zu decken. Eine paradoxe Entwicklung, wenn Nachhaltigkeit und soziale Teilhabe zentrale Werte einer demokratischen Gesellschaft sein sollen.
Spannungsfelder der digitalen Gesellschaft
Die Digitalisierung schafft enorme Erleichterungen – aber auch neue ethische Spannungsfelder:
- Autonomieverlust durch algorithmische Entscheidungen
- Desinformation und Deep Fakes, die demokratische Prozesse gefährden
- Clickworker im digitalen Prekariat, die unter prekären Bedingungen KI-Systeme trainieren
- Verlust an Authentizität im Bildungssystem durch generative KI
- Soziale Ungleichheit, wenn vulnerable Gruppen digital abgehängt werden
Die Prognosen sind deutlich: Bis zum Jahr 2100 könnten bis zu 75 Prozent aller heutigen Jobs automatisiert sein. Wer gut ausgebildet ist, wird sich neu orientieren können. Aber was geschieht mit allen anderen?
Mensch im Mittelpunkt – auch in der Gemeinde
Eine der zentralen Aussagen von Gremsl lautet: Nicht der Mensch darf Mittel für die Technologie sein – die Technologie muss Mittel für den Menschen bleiben. Das bedeutet konkret: Die Digitalisierung darf nicht über Köpfe hinweg geschehen. Sie muss so gestaltet werden, dass sie menschliche Würde wahrt und Teilhabe für alle ermöglicht – unabhängig von Alter, Wohnort oder Bildungsstand.
Gerade Gemeinden sind hier Schlüsselakteure: Sie stehen den Bürger:innen am nächsten. Durch niederschwellige Digital-Workshops, wie sie etwa von „Saferinternet“ oder der „ÖIAT Academy“ angeboten werden, kann Medienkompetenz gefördert und Selbstverantwortung gestärkt werden – etwa beim Schutz vor Online-Betrug, Deep Fakes oder problematischem Konsumverhalten.
Top-down und Bottom-up: Gemeinsame Verantwortung
Verantwortung muss auf mehreren Ebenen übernommen werden. Politisch – etwa durch Regelwerke wie den „AI Act“ der EU, der risikobasierte Kategorien für KI-Anwendungen einführt.
Aber auch jede und jeder Einzelne ist gefordert: Was ist mein Beitrag zu einer gerechten digitalen Gesellschaft? Wie gehe ich selbstbestimmt und kritisch mit KI um?
Konkrete ethische Leitlinien
Folgende Prinzipien, wie sie etwa von der EU-Kommission oder Ethiker:innen wie Grunwald und Kirchschläger formuliert wurden, sind für die kommunale Praxis besonders relevant:
- Achtung der menschlichen Autonomie
- Schadensvermeidung
- Fairness
- Erklärbarkeit
- Transparenz
- Nachvollziehbarkeit
- Verständlichkeit
- Verantwortung
Diese Prinzipien sollten bei der Einführung digitaler Systeme in Gemeinden stets mitgedacht werden – von der digitalen Verwaltung über Smart-City-Konzepte bis hin zu Bildungsinitiativen.
Fazit: Digitalisierung aktiv gestalten
Digitalisierung ist kein Schicksal, sondern ein Gestaltungsauftrag. Gemeinden in Österreich haben die Möglichkeit – und die Pflicht – diese Transformation menschenwürdig, nachhaltig und gerecht zu gestalten. Dafür braucht es ethische Reflexion, politische Regelungen und praktische Bildungsangebote.
Oder wie es Thomas Gremsl formuliert: „KI für den Menschen – und nicht statt des Menschen.“
Weiterführende Informationen:
Institut für Ethik und Gesellschaftslehre, Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Graz