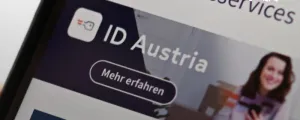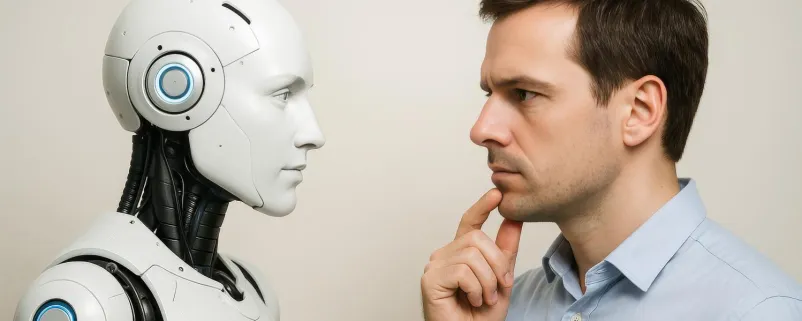
Dieses Bild wurde von ChatGPT erstellt. Folgender Prompt (Textanweisung an die KI) wurde verwendet: „Eine fotorealistische Weitwinkelszene, die eine Person neutralen Geschlechts und modernen Aussehens zeigt, die in der Mitte eines digitalen Raums steht. Filmische Beleuchtung, fotorealistisches Rendering, redaktioneller Illustrationsstil.“
Digitalisierung
Wunderwerk KI – Chancen, Grenzen und Gefahren
Kaum ein Thema wird derzeit so heiß diskutiert wie die künstliche Intelligenz, kurz KI. Von Chatbots bis zur automatischen Bilderkennung, von Navigationssystemen bis hin zur intelligenten Datenanalyse – KI ist längst Teil unseres Alltags geworden. Doch was steckt wirklich dahinter?
Künstliche Intelligenz bezeichnet Computersysteme, die Aufgaben ausführen, die üblicherweise menschliche Intelligenz erfordern – etwa das Verstehen von Sprache, das Erkennen von Mustern oder das Treffen von Entscheidungen. Vor allem das Verarbeiten, Analysieren und Interpretieren von großen Datenmengen in (globalen) Netzwerken wie dem World Wide Web, ist die große Stärke der KI.
Unterschieden wird zwischen starker und schwacher KI. Die „schwache KI“ begegnet uns heute bereits überall – etwa in Sprachassistenten wie Siri oder Alexa, in Suchmaschinen, in automatisierten Kundenservices. Die sogenannte „starke KI“, die mit menschlichem Denken vergleichbar wäre, also eine Maschine mit echter Bewusstseins- und Denkfähigkeit, ist noch Zukunftsmusik.
Was kann KI – und was nicht?
KI ist erstaunlich leistungsfähig: Sie kann Texte schreiben, Bilder erzeugen, Krankheiten in Röntgenbildern erkennen oder Verkehrsflüsse analysieren. In der Gemeindepraxis kann die KI helfen, Prozesse zu automatisieren, die Mitarbeiter bei der Bearbeitung von Anträgen zu unterstützen, oder Prognosen treffen – etwa für den Energieverbrauch oder den Wasserbedarf. Die KI ist in bestimmten Bereichen schneller, präziser und ermüdungsfrei – vor allem beim Sortieren großer Datenmengen, beim Erkennen von Mustern oder bei Routinetätigkeiten.
Aber: Die KI hat Grenzen, sie ist nicht allwissend. Sie versteht keine Zusammenhänge im menschlichen Sinn, sie kann Emotionen nicht wirklich nachempfinden und sie ist nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde. Denn sie reproduziert nur das, was ihr „beigebracht“ wurde – inklusive möglicher Fehler in der Datenbasis. Mangelhafte oder einseitige Datengrundlagen können deshalb zu verzerrten Ergebnissen führen – mit teils gravierenden Folgen. Aber auch kreative oder ethische Entscheidungen bleiben – zum Glück – dem Menschen vorbehalten.
Die wichtigsten Tools
Inzwischen gibt es eine Vielzahl von KI-gestützten Werkzeugen und Apps. Hier eine kleine Auswahl zum ersten Ausprobieren – einfach für die kostenfreien Versionen registrieren und keine Scheu vor Versuchen haben:
- ChatGPT: Ein KI-Text- und Bildgenerator, der bei der Erstellung von Texten, Konzepten oder Bildern helfen kann.
- Canva: KI-Bildgenerator für Design und Plakatgestaltung.
- Midjourney: KI-gestützte Bilderzeugung.
- DeepL Write: Optimieren Texte auf Stil, Grammatik oder Übersetzung.
Auch im kommunalen Umfeld gewinnt die künstliche Intelligenz an Bedeutung. Erste Pilotprojekte zeigen, wie die KI mittels gestützter Bürgeranfrage-Systeme (ChatBots) Anfragen vorsortieren oder automatisch beantworten kann.
Dos and Don'ts – verantwortungsvoller Umgang mit KI
Wie jede Technologie sollte auch künstliche Intelligenz immer mit Bedacht eingesetzt werden – besonders im öffentlichen Bereich. Der Einsatz von KI eröffnet viele Möglichkeiten, erfordert aber auch Sensibilität. Einige Grundregeln, die man beachten sollte:
- Transparenz schaffen: Immer offenlegen, wenn die KI zum Einsatz kommt. Die Bürger haben ein Recht, zu wissen, ob Texte, Bilder oder Videos künstlich generiert wurden.
- Menschliche Kontrolle sicherstellen: Die KI darf unterstützen, aber menschliche Entscheidungen nicht ersetzen.
- Kritisch bleiben: Nicht blind auf KI-Ergebnisse vertrauen – sie können falsch oder voreingenommen sein.
- Datenschutz wahren: Nur notwendige, anonymisierte Daten beim Arbeiten mit der KI verwenden.
- Klein anfangen: Pilotprojekte testen, statt sofort flächendeckend umsetzen.
Herausforderungen und Gefahren: Datenschutz im Fokus
Einer der größten Kritikpunkte beim Einsatz von künstlicher Intelligenz ist der Umgang mit Daten bzw. der Datenschutz. Viele KI-Systeme – insbesondere cloudbasierte Anwendungen – verarbeiten Daten außerhalb Europas. Das wirft Fragen nach der DSGVO-Konformität auf. Gemeinden tragen hier besondere Verantwortung, denn sie verwalten sensible Informationen wie persönliche Daten von Bürgern, Gesundheits- oder Sozialdaten bzw. Daten aus Bauverfahren oder Gemeindevorhaben. Daher gilt: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz sollte immer auf Basis einer klaren Rechtsgrundlage erfolgen.
Hinzu kommen ethische und gesellschaftliche Fragen: Wie viel Kontrolle geben wir Maschinen? Wie sichern wir Fairness und Gerechtigkeit? Und wie verhindern wir eine digitale Kluft, bei der nur jene profitieren, die Zugang und Know-how haben?
Fazit: Chancen nutzen – Verantwortung bewahren
Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, kein Ersatz für menschliches Urteilsvermögen. Sie kann Gemeinden helfen, effizienter, moderner und bürgernäher zu agieren – wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird.
Wichtig ist, dass KI nicht über Menschen entscheidet, sondern für Menschen arbeitet. Mit Augenmaß, Transparenz und Respekt vor Datenschutz und Gemeinwohl kann KI ein Baustein für eine zukunftsfitte Gemeinde sein.
Der Beitrag erschien in der NÖ Gemeinde 6/2025.
Wo Gemeinden heute schon KI einsetzen könnten
Automatische Beantwortung von Bürgeranfragen
Optimierung von Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden
Unterstützung bei der Planung von Verkehrsflüssen
Digitalisierung und Analyse von Gemeindedaten
Erstellung von Texten für Aussendungen oder Webseiten