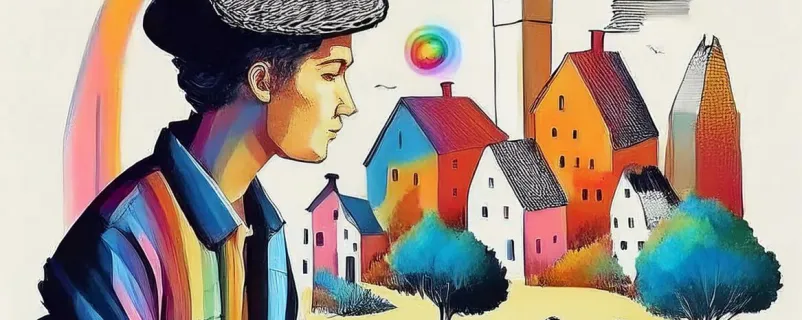
Demografie
Politische Beteiligung von Jugendlichen auf Gemeindeebene
Jugendliche zeigen politisches Interesse, fühlen sich jedoch von der etablierten Politik oft nicht angesprochen. Auf Gemeindeebene könnte Beteiligung besser gelingen, da hier konkrete, lebensnahe Themen behandelt werden und Ergebnisse rascher sichtbar sind. Dennoch sehen nur wenige Jugendliche reale Mitbestimmungsmöglichkeiten in ihrer Gemeinde.
Der Artikel analysiert politische Einstellungen und Beteiligungschancen junger Menschen in Österreich und entwickelt Empfehlungen, wie ihre Partizipation auf kommunaler Ebene gestärkt werden kann.
Gerade auf Gemeindeebene bietet sich aus Sicht der Interessen und Motivation von Jugendlichen eine politische Beteiligung an. Jugendliche sind seltener bereit als Angehörige älterer Generationen, sich langfristig zu binden, das heißt Mitgliedschaften in politischen Parteien und Organisationen sind für sie häufig wenig attraktiv. Zudem sind Jugendliche eher bereit, sich zu engagieren, wenn es um konkrete Ziele geht, die in absehbarer Zeit erreicht werden können, was ebenfalls eher auf Gemeindeebene denn in größeren Strukturen umgesetzt werden kann.
Noch ein Punkt spricht dafür, dass ein Engagement auf lokaler Ebene eher einem jugendlichen politischen Zugang entgegenkommt: Für Anliegen, die die eigene Lebenswelt und das nähere Umfeld betreffen, steigt ihre Bereitschaft für ein Engagement (Waechter 2012). Politisches Engagement auf Gemeindeebene würde vielen Interessen junger Menschen entgegenkommen: Dort werden konkrete, die Menschen im Umfeld unmittelbar betreffende Anliegen behandelt, die Ergebnisse des politischen Handelns sind häufig kurzfristig sichtbar und auch temporäres Engagement kann etwas bewirken.
Wie ist es nun aber wirklich um die politische Beteiligung von Jugendlichen und jungen Menschen auf lokaler Ebene in Österreich bestellt und wie könnte diese gestärkt werden? Diesen Fragen wollen wir in diesem Artikel nachgehen.
Wir betrachten zunächst, ob Jugendlichen politisches Engagement überhaupt wichtig ist und sehen uns das politische Interesse von jungen Menschen an. Anschließend prüfen wir, ob sie das Gefühl haben, dass es für sie in der Politik und der Gemeinde Möglichkeiten der Mitbestimmung gibt, und wir beleuchten, wie es um die Wahlbeteiligung und Wahlberechtigung junger Menschen bestellt ist. Auf dieser Grundlage haben wir eine Reihe von Empfehlungen für die politische Miteinbeziehung von Jugendlichen und jungen Menschen auf Gemeindeebene entwickelt, die den Abschluss dieses Artikels bilden.
Ein erheblicher Teil der jungen Generation findet politisches Engagement wichtig
In der österreichischen Studie „Lebenswelten 2020 – Werthaltungen junger Menschen in Österreich“, in der 14.400 Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren zu ihren Werthaltungen und Verhaltensbereitschaften befragt wurden, wurde auch erhoben, wie wichtig es Jugendlichen ist, sich politisch zu engagieren (Jugendforschung Pädagogische Hochschulen Österreichs 2021: 260).
40 Prozent der Jugendlichen sagen, dass ihnen politisches Engagement (sehr) wichtig ist, 60 Prozent finden dies eher oder völlig unwichtig. Jungen Männern ist politisches Engagement etwas häufiger wichtig als den jungen Frauen. Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn man nach dem politischen Interesse fragt (Ott et al. 2021: 154). 11 Prozent der Jugendlichen haben ein starkes Interesse an Politik, 34 Prozent sind zumindest etwas interessiert.
Jugendliche an maturaführenden Schulen interessieren sich häufiger für Politik als Jugendliche an Pflichtschulen, berufsbildenden mittleren und Berufsschulen. Auch scheint das politische Interesse mit zunehmendem Alter zu steigen, die Unterschiede sind jedoch gering und statistisch nicht signifikant. In einem deutlichen Zusammenhang mit dem politischen Interesse steht, ob Jugendliche den Klimawandel als bedrohlich empfinden. Klimawandel und Umweltprobleme sind zentrale Anliegen, die junge Menschen dazu bringen, sich politisch zu interessieren und sich zu engagieren.
Wenig Vertrauen in Politik und Politiker:innen
Allerdings zeigen deutsche und österreichische Studien, dass sich Jugendliche trotz ihres durchaus vorhandenen politischen Interesses von der Politik nicht ausreichend vertreten fühlen. In der deutschen Shell Jugendstudie 2024 gibt etwa weniger als die Hälfte der befragten Jugendlichen an, den politischen Parteien zu vertrauen (Schneekloth/Albert 2024: 70).
Ergebnisse der Befragung des Gallup Instituts (2020: 27) zeigen, dass sich die Jugendlichen in Österreich in den eigenen Bedürfnissen nur wenig oder gar nicht angesprochen fühlen. Während die Jugendlichen als aktuellen Schwerpunkt in der Politik vor allem Wirtschaft als Thema wahrnehmen, sehen sie die Themen, die ihnen wichtig wären (Bildung, Umwelt, Jugend und Soziales), stark vernachlässigt.
Auch die Wahltagsbefragung im Zuge der Wiener Gemeinderatswahl 2020 zeigt, dass jungen Menschen unter 30 Jahren Klima und Umwelt wichtiger waren als anderen Altersgruppen (SORA/Institut für Strategieanalysen 2020: 7). Jugendliche scheinen offenbar mit den etablierten Parteien und dem politischen Betrieb zu fremdeln und sich eher wenig angesprochen zu fühlen. Da die politischen Prozesse auf Gemeindeebene stärker nachvollziehbar, thematisch enger an der Lebenswelt und auch vor Ort leichter beeinflussbar sind, stellt sich die Frage, ob Jugendliche sich hier eventuell besser vertreten fühlen.
Haben Jugendliche das Gefühl, in den Gemeinden mitbestimmen zu können?
In Rahmen der Studie „Lebenswelten 2020 – Werthaltungen junger Menschen in Österreich“ wurden in zwei Bundesländern, in Vorarlberg und der Steiermark1, die Jugendlichen gefragt, wie sehr sie in verschiedenen Lebensbereichen – Familie, Freundeskreis, Schule, Politik und Gemeinde – mitbestimmen können. Die Frage lautete: „Alles in allem, wie sehr kannst du mitbestimmen…“ und dann wurden die Lebensbereiche Familie, Freundeskreis, Schule, Gemeinde und Politik abgefragt. Die Antwortoptionen rangierten auf einer fünfstufigen Skala zwischen sehr viel, viel, teils-teils, wenig und sehr wenig.
Dabei schneidet die Politik im Vergleich zu anderen Bereichen zwar generell bescheiden ab, es zeigt sich aber auch, dass auf Gemeindeebene vergleichsweise mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten gesehen werden als in der Politik. Da die Ergebnisse in Vorarlberg und der Steiermark sehr ähnlich sind und die Steiermark das größere Bundesland ist, berichten wir im Folgenden vor allem die Ergebnisse aus der Steiermark.
Von den Jugendlichen in der Steiermark sagen 3 Prozent, dass sie in ihrer Gemeinde sehr viel, 5 Prozent, dass sie viel und 14 Prozent, dass sie teils-teils mitbestimmen können. 21 Prozent geben an, wenig und 35 Prozent sehr wenig mitbestimmen zu können. 23 Prozent wählen die Option „weiß nicht“. Nimmt man die Angaben für sehr viel, viel und teil-teils zusammen, sind es mit 22 Prozent etwas mehr ein Fünftel der Jugendlichen, die angeben, auf Gemeindeebene zumindest etwas mitbestimmen zu können.
Angesichts des Umstandes, dass 40 Prozent der Jugendlichen sagen, dass sie politisches Engagement wichtig finden, und vor dem Hintergrund der eingangs formulierten Annahme, dass politisches Engagement auf Gemeindeebene den Interessen junger Menschen entgegenkommt, weil dort konkrete, die Menschen im Umfeld unmittelbar betreffende Anliegen behandelt werden, die Ergebnisse des politischen Handelns häufig kurzfristig sichtbar sind und auch temporäres Engagement etwas bewirken kann, ist das kein besonders hoher Wert. Der hohe Anteil von Jugendlichen, der hier „weiß nicht“ angibt, deutet zudem darauf hin, dass viele sich bisher nicht damit auseinandergesetzt haben, welche Möglichkeiten der Mitbestimmung es denn überhaupt gäbe. Die ganz überwiegende Mehrheit sieht für sich keine Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Gemeinde.
Wovon hängt es ab, ob Jugendliche die Meinung haben, auf Gemeindeebene zumindest etwas mitbestimmen zu können?
Junge Männer haben deutlich öfter das Gefühl mitbestimmen zu können als junge Frauen. Von den männlichen Jugendlichen sagen 25 Prozent, dass sie zumindest etwas (sehr viel, viel oder teils-teils) in ihren Gemeinden mitbestimmen können, von den weiblichen Jugendlichen sind es mit 18 Prozent deutlich weniger. Offenbar sprechen die Themen und Strukturen auf Gemeindeebene junge Männer stärker an als junge Frauen. Interessant ist auch, dass es auf Gemeindeebene gelingt, stärker die Jugendlichen auf den nicht-maturaführenden Schulen anzusprechen, somit jene Schulformen, die stärker von jungen Männern besucht werden. Es könnte daraus auch geschlossen werden, dass Jugendliche in nicht-maturaführenden Schulen stärker mit der Gemeinde oder Region verbunden sind.
Auch das Alter der Jugendlichen spielt eine Rolle, denn mit zunehmendem Alter steigt das Gefühl, mitbestimmen zu können, sukzessive an. Von jenen, die 16 Jahre und älter und damit wahlberechtigt sind – vorausgesetzt, sie besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft (bei Nationalrats- und Landtagswahlen) oder zumindest die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Landes (bei Gemeinderatswahlen mit Ausnahme Wiens) – sagt etwa ein Viertel, dass sie mitbestimmen können, während es bei den Jüngeren deutlich weniger sind. Da nur Jugendliche in der achten, neunten und zehnten Schulstufe befragt wurden, ist die Altersspanne jedoch relativ gering.
Interessant sind auch die Unterschiede nach der Wohnregion, denn je städtischer die Jugendlichen wohnen, desto häufiger geben sie an, mitbestimmen zu können. Von den Jugendlichen, die eher städtisch wohnen, geben 39 Prozent an, zumindest etwas (sehr viel, viel oder teil-teils) in ihren Gemeinden mitbestimmen zu können. Von jenen, die eher ländlich wohnen, sagen dies nur 19 Prozent. Offenbar gelingt es den Städten deutlich besser, junge Menschen in die Politik einzubinden.
Zudem gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen den wahrgenommenen Mitbestimmungsmöglichkeiten und der Bedeutung, die Jugendliche dem politischen Engagement zumessen. Je wichtiger sie es finden, sich politisch zu engagieren, desto mehr können sie auch mitbestimmen. Auch ein hohes politisches Interesse geht mit verstärkter Mitbestimmung einher.
Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse, dass die Gemeinden bisher mit ihren Beteiligungsangeboten nur einen kleinen Teil der jungen Menschen erreichen. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass es hier ein erhebliches Potential gibt, diejenigen Jugendlichen, die sich für Politik interessieren und für die Engagement grundsätzlich wichtig ist, verstärkt einzubinden. Gerade in den Städten scheint dies in der Steiermark teilweise schon recht gut zu gelingen.
Jugend und Wahlbeteiligung
Da die Themen der politischen Parteien wenig an den Interessen und Anliegen junger Menschen orientiert sind, fühlen sich diese im Vergleich zu älteren Generationen auch weniger von der Politik abgeholt und als Wähler:innen angesprochen. Dementsprechend zeigte sich etwa in den deutschen Bundestagswahlen 2021, dass die Wahlbeteiligung tendenziell mit zunehmendem Alter steigt (Demographieportal 2025). Allerdings müssen junge Erstwähler:innen auch erst in das politische System hineinwachsen und lernen, diese Möglichkeit der Mitbestimmung zu nutzen (Waechter 2012).
Innerhalb der Gruppe der 16- bis 19-Jährigen scheint die Wahlbeteiligung nicht wesentlich anzusteigen. Nach der Wahlaltersenkung auf 16 Jahre in einigen deutschen Bundesländern2 gab es zwischen den 16- und 17-Jährigen auf der einen Seite und den 18- bis 19-Jährigen auf der anderen Seite keine nennenswerten Unterschiede in ihrer Wahlbeteiligung.
Auch hinsichtlich ihres politischen Interesses und ihrem politischen Wissen unterschieden sich die 16- und 17-Jährigen nicht von den 18- und 19-Jährigen (Faas/Leininger 2020; Faas/Könneke 2021). Für die österreichischen Nationalratswahlen wurde festgestellt, dass die 16- und 17-jährigen Erstwähler:innen sogar besser informiert sind als die 18- bis 20-jährigen Erstwähler:innen (Kritzinger et al. 2017). Auch hier zeigt sich also wieder, dass es nicht am fehlenden Interesse der jungen Menschen liegen dürfte, wenn sie sich nicht politisch engagieren.
Jugend und Wahlberechtigung: Wien ist anders
In letzter Zeit wird in Österreich vermehrt diskutiert, dass es demokratiepolitisch bedenklich ist, dass ein steigender Anteil der in Österreich lebenden Menschen nicht an bundesweiten Wahlen wahlberechtigt ist, weil sie zwar in Österreich leben (und zum Teil auch in Österreich geboren sind), aber keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. In Europawahlen und Gemeinderatswahlen sind auch EU-Bürger:innen, die ihren Hauptwohnsitz in einer österreichischen Gemeinde haben, wahlberechtigt. Da die Wiener Gemeinderatswahlen aber gleichzeitig Landtagswahlen darstellen, dürfen hier nur Wiener:innen mit österreichischer Staatsbürgerschaft wählen.
Davon ist die junge Bevölkerung überproportional betroffen: „Besonders junge Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind vom Ausschluss vom Wahlrecht betroffen. 40,9 Prozent der Wiener:innen zwischen 16 und 24 Jahren haben nicht die österreichische Staatsbürgerschaft.“ (Stadt Wien 2025). Wenn wir also nach der Bereitschaft zum Engagement junger Menschen fragen, müssen wir auch in den Blick nehmen, dass viele junge Menschen in Österreich von einer wichtigen Form der Mitbestimmung ausgeschlossen sind. Es könnte zwar argumentiert werden, dass es noch weitere Möglichkeiten der Teilhabe gibt, aber es muss doch auch von einem Gefühl des Ausgeschlossenseins und einer negativen Signalwirkung ausgegangen werden, die ein weiteres Engagement eher verhindert als fördert.
Conclusio mit Empfehlungen
Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass es gerade auf Gemeindeebene viel Potential gäbe, Jugendliche mit ins Boot zu holen und zum politischen Engagement zu motivieren. Allerdings fühlen sich Jugendliche nicht von Politik und Gemeinde abgeholt, auch wenn sie prinzipiell politisch interessiert sind.
Auf dieser Grundlage können folgende Empfehlungen ausgesprochen werden:
- Jugendlichen müssen Chancen zur Beteiligung geboten werden, und es müssen mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung für Jugendliche geschaffen werden
- Jugendliche brauchen Räume, in denen sie sich mit Gleichaltrigen treffen und austauschen können.
- Jugendlichen Räume zur Verfügung stellen
- Jugendliche müssen ermutigt und dabei unterstützt werden, ihre Bedürfnisse und Anliegen zu erkennen und artikulieren zu können.
- Jugendliche bei ihrer Auseinandersetzung unterstützen
- Jugendlichen müssen niederschwellige Möglichkeiten geboten werden, ihre Anliegen auf Gemeindeebene einzubringen.
- Jugendlichen niederschwelligen Zugang bieten
- In Erfahrung bringen, was Jugendlichen in der Gemeinde wichtig ist, was fehlt und was vielleicht nicht mehr funktioniert.
- Die Perspektive der Jugendlichen erkennen und verstehen
- Nicht nur die konkreten Anliegen Jugendlicher berücksichtigen, sondern Jugend als Querschnittsthema berücksichtigen: Was bedeutet eine Maßnahme oder die konkrete Umsetzung, z.B. einer Fußgängerzone, für Jugendliche?
- Jugend als Querschnittsthema immer mitdenken
- Sich mit örtlichen Jugendvereinen und Jugendverbänden regelmäßig austauschen, nicht nur anlassbezogen
- Zusammenarbeit mit Jugendvereinen und -verbänden
- Mädchen als eigene Zielgruppe betrachten: Wie können Mädchen auf dem Weg zum politischen Engagement in der Gemeinde unterstützt werden?
- Mädchen als Zielgruppe
- Verständnis und Berücksichtigung, dass es auch in einer kleineren Gemeinde nicht die Jugend gibt, sondern verschiedene Jugendliche mit verschiedenen Bedürfnissen – Jugend ist divers.
- Verschiedenheit der Bedürfnisse berücksichtigen
- Wir bedanken uns bei Martin Auferbauer von der PH Steiermark für die zur Verfügungstellung der Daten.
- In Österreich wurde das Wahlalter für alle Wahlen (Gemeinderat, Landtag, Nationalrat, Bundespräsident:in, EU) schon 2007 von 18 auf 16 Jahre gesenkt, womit Österreich international eine Vorreiterrolle einnimmt.
Literatur
Demografie-Portal (2025): https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/wahlbeteiligung.html
Jugendforschung Pädagogische Hochschulen Österreichs (Hg.) (2021): Lebenswelten 2020. Werthaltungen junger Menschen in Österreich. Innsbruck/Wien: Studien Verlag.
Faas, Thorsten/Leininger, Arndt (2020): Wählen mit 16? Ein empirischer Beitrag zur Debatte um die Absenkung des Wahlalters. OBS-Arbeitspapier 41. Frankfurt am Main: Otto Brenner Stiftung.
Faas, Thorsten/Könneke, Anton (2021): Wählen ab 16? Pro und Contra. Politik und Zeitgeschichte 38–39/2021, S. 29–35.
Kritzinger, Sylvia/Wagner, Markus/Glavanovits, Josef (2017): ErstwählerInnen bei der Nationalratswahl 2017. Forschungsbericht. Wien: Universität Wien.
Ott, Martina/Gabriel, Herbert/Resinger, Paul/Wutti, Daniel (2021): Politik, Demokratie und Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, in: Jugendforschung Pädagogische Hochschulen Österreichs (Hg.) Lebenswelten 2020. Werthaltungen junger Menschen in Österreich. Innsbruck/Wien: Studien Verlag, S. 151–189.
Schneekloth, Ulrich/Albert, Mathias (2024): Jugend und Politik, in: Shell Deutschland Holding (Hg.) 19. Shell Jugendstudie. Jugend 2024. Weinheim Basel, S. 43–101.
SORA/Institut für Strategieanalysen (2020): Wahlanalyse Gemeinderatswahl Wien 2020. Forschungsbericht im Auftrag des ORF. Wien: SORA/Institut für Strategieanalysen.
Stadt Wien (2025): Wiener Bevölkerung 2024: Daten und Fakten zu Migration und Integration. https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html
Waechter, Natalia (2012): Jung, kulturell und politisch aktiv! Politische Partizipation und informelle Selbst-Bildung im Rahmen musikorientierter Jugendkulturen, in: Dossier Kulturelle Bildung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/65374/musikorientierte-jugendkulturen










