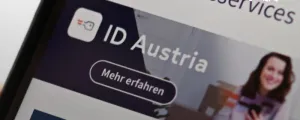Digitale Zwillinge ermöglichen präzise Planung, vermeiden teure Nachbesserungen und schaffen Transparenz für Bürger und Entscheidungsträger.
© Heng Heng - AI Stock - stock.adobe.com
Planung
Wie Gemeinden von digitalen Zwillingen profitieren
Digitale Zwillinge helfen Gemeinden dabei, ihre Gebäude und Infrastrukturen vorausschauend zu verwalten. Sie simulieren Energiesparmaßnahmen, optimieren Bauprojekte und erleichtern die Wartung kommunaler Immobilien – ein Schlüssel zur smarten Zukunftsfähigkeit von Städten und Dörfern.
Digitale Zwillinge – virtuelle Abbilder realer Gebäude und Infrastrukturen – bieten Gemeinden enorme Vorteile bei der Planung, Sanierung und Verwaltung öffentlicher Immobilien. Besonders kleine und mittlere Kommunen können durch ihren Einsatz Ressourcen effizienter nutzen, Betriebskosten senken und nachhaltige Entscheidungen treffen.
1. Gebäudesanierung:
- Zustandsanalyse und Planung: Durch die Erstellung eines digitalen Zwillings können bestehende Gebäude detailliert erfasst und analysiert werden. Dies ermöglicht eine präzise Planung von Sanierungsmaßnahmen, da Schwachstellen frühzeitig identifiziert und behoben werden können.
- Simulation von Energiesparmaßnahmen: Verschiedene Sanierungsszenarien lassen sich virtuell durchspielen, um deren Auswirkungen auf Energieeffizienz und Raumklima zu bewerten. So können optimale Maßnahmen ausgewählt und deren Effektivität vorab abgeschätzt werden.
2. Neubau:
- Effiziente Planung und Kollisionsprüfung: Im Neubau ermöglicht der digitale Zwilling eine integrale Planung, bei der alle Gewerke in einem gemeinsamen Modell arbeiten. Dies reduziert Planungsfehler und verhindert Kollisionen zwischen verschiedenen Bauteilen oder Systemen.
- Virtuelle Inbetriebnahme: Noch vor der realen Fertigstellung können Gebäudetechnik und -systeme virtuell getestet und optimiert werden. Dies führt zu einer reibungsloseren Inbetriebnahme und reduziert Anpassungen während der Bauphase.
3. Verwaltung kommunaler Immobilien:
- Kontinuierliches Monitoring und Wartung: Im laufenden Betrieb ermöglicht der digitale Zwilling ein Echtzeit-Monitoring von Gebäudedaten. Anomalien oder Wartungsbedarfe können frühzeitig erkannt und gezielte Maßnahmen ergriffen werden, was die Betriebskosten senkt und die Lebensdauer der Gebäude verlängert.
- Datenbasierte Entscheidungsfindung: Durch die Integration verschiedener Datenquellen bietet der digitale Zwilling eine umfassende Informationsbasis für Entscheidungen bezüglich Umbauten, Nutzungsänderungen oder Investitionen.
Ein praktisches Beispiel für den Einsatz digitaler Zwillinge findet sich in der Stadt Speyer. Dort verbindet der urbane digitale Zwilling Raum- und Klimadaten in einem 3D-Modell, das Simulationen ermöglicht, um beispielsweise die Auswirkungen von Klimaveränderungen auf städtische Infrastrukturen zu bewerten.
Die Stadt Speyer hat für den Aufbau ihres digitalen Zwillings eine Vollförderung des Klimaschutzministeriums Rheinland-Pfalz in Höhe von 978.000 Euro erhalten.
Zusätzlich fallen jährliche Kosten von rund 70.000 Euro für Lizenzen des Geoinformationssystems (GIS) und des digitalen Zwillings für alle städtischen Abteilungen an.
Zusammenfassend bieten digitale Zwillinge für kommunale Immobilien erhebliche Potenziale zur Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen in Planung, Bau und Betrieb.
Infrastrukturmanagement, Stadtplanung und Ressourceneffizienz
Auch kleine und mittlere Landgemeinden können erheblich von der Implementierung digitaler Zwillinge profitieren, insbesondere in den Bereichen Infrastrukturmanagement, Stadtplanung und Ressourceneffizienz. Hier sind einige konkrete Anwendungsbeispiele:
Infrastrukturmanagement:
- Straßen- und Verkehrsüberwachung: Durch digitale Abbilder des Straßennetzes können Gemeinden den Zustand von Straßen in Echtzeit überwachen, Wartungsbedarfe frühzeitig erkennen und Verkehrsflüsse optimieren.
Stadtplanung und -entwicklung:
- Virtuelle Bauprojekte: Bevor physische Bauprojekte realisiert werden, können sie digital modelliert werden, um potenzielle Probleme zu identifizieren und die Auswirkungen auf die Umgebung zu bewerten.
Energie- und Ressourcenmanagement:
- Optimierung des Energieverbrauchs: Durch die Simulation von Energieflüssen in öffentlichen Gebäuden können Einsparpotenziale identifiziert und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umgesetzt werden.
Umwelt- und Klimaschutz:
- Hochwasservorsorge: Digitale Zwillinge von Flussläufen und Überschwemmungsgebieten ermöglichen die Simulation von Hochwasserszenarien, sodass präventive Maßnahmen geplant werden können.
Bürgerbeteiligung und Transparenz:
- Virtuelle Stadtführungen: Gemeinden können digitale Zwillinge nutzen, um Bürgern geplante Projekte oder historische Entwicklungen virtuell zu präsentieren, was Transparenz und Akzeptanz fördert.
Best-Practice-Beispiele aus Deutschland ...
- Projekt "TwinBy" in Bayern: Im Rahmen des Projekts „TwinBy – Digitale Zwillinge für Bayern" wurden in mehreren Kommunen digitale Zwillinge implementiert, um die kommunale Resilienz zu stärken. Diese digitalen Modelle unterstützen bei der Planung und Entscheidungsfindung in Bereichen wie Hochwasserschutz und Verkehrsplanung.
- Stadt Herrenberg: Die Stadt Herrenberg in Baden-Württemberg hat einen digitalen Zwilling entwickelt, um Bürgerbeteiligung zu fördern und städtebauliche Planungen transparenter zu gestalten. Bürger können virtuell durch geplante Baugebiete navigieren und Feedback geben.
Durch den Einsatz digitaler Zwillinge können auch kleinere Gemeinden ihre Planungsprozesse optimieren, Ressourcen effizienter nutzen und die Bürgerbeteiligung stärken. Die genannten Beispiele zeigen, dass die Technologie nicht nur für Großstädte, sondern auch für kleinere Kommunen praktikabel und vorteilhaft ist.
... und in Österreich
Auch in Österreich setzen Städte und Gemeinden zunehmend auf die Technologie des digitalen Zwillings, um Stadtplanung, Infrastrukturmanagement und Bürgerbeteiligung zu verbessern. Hier sind einige Beispiele:
Klagenfurt:
Die Landeshauptstadt Klagenfurt hat ein realitätsgetreues 3D-Abbild des gesamten Stadtgebiets erstellt. Dieser digitale Zwilling ermöglicht unter anderem die Simulation von Solarpotenzialen auf Dachflächen sowie die Analyse von Bodennutzung und Versiegelung. Zukünftig sollen auch Bauprojekte virtuell visualisiert werden, um Planungsprozesse zu optimieren.
Seiersberg-Pirka:
Die Gemeinde Seiersberg-Pirka setzt auf Geodaten als Schlüssel zur Modernisierung. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und die Erstellung eines digitalen Zwillings werden Geodaten effizient verwaltet und für verschiedene Anwendungen genutzt, beispielsweise zur Verbesserung der Infrastrukturplanung.
Interreg-Projekt „Urbane Digitale Zwillinge“:
Im Rahmen des Interreg-Projekts arbeiten bayerische und österreichische Gemeinden gemeinsam an der Entwicklung urbaner digitaler Zwillinge. Ziel ist es, durch virtuelle Abbilder der Städte und Gemeinden Planungsmaßnahmen, insbesondere zur Klimaanpassung, virtuell zu evaluieren und grenzübergreifende Strategien zu entwickeln.
Diese Beispiele zeigen, dass digitale Zwillinge auch in österreichischen Kommunen erfolgreich eingesetzt werden, um Planungsprozesse zu verbessern, Ressourcen effizienter zu nutzen und die Bürgerbeteiligung zu stärken.
Ja, in Österreich gibt es weitere Initiativen und Projekte, die digitale Zwillinge einsetzen, um verschiedene Bereiche zu optimieren:
Projekt „Twin2Share“:
Dieses Forschungsprojekt zielt darauf ab, digitale Zwillinge zur Unterstützung von Energiegemeinschaften über ihren gesamten Lebenszyklus einzusetzen. Der Fokus liegt auf der Optimierung von Energieeffizienz und Kosten, dynamischem Lastmanagement und der Einbindung von Nutzer:innen, um eine nachhaltige Energienutzung und die Stabilisierung des Stromnetzes zu fördern.
Digitaler Zwilling in der Tourismuswirtschaft:
Die Arbeitsgruppe „Digital Twins in Tourism“ des Digital Innovation Hub West beschäftigt sich mit der Anpassung digitaler Zwillinge an die spezifischen Herausforderungen der Tourismusbranche. Ziel ist es, digitale Abbilder von Tourismusregionen zu erstellen, um beispielsweise Besucherströme zu analysieren und die Infrastrukturplanung zu verbessern.
Diese Beispiele verdeutlichen, dass digitale Zwillinge in Österreich in verschiedenen Sektoren Anwendung finden, um Prozesse zu verbessern und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.