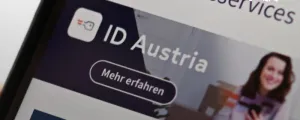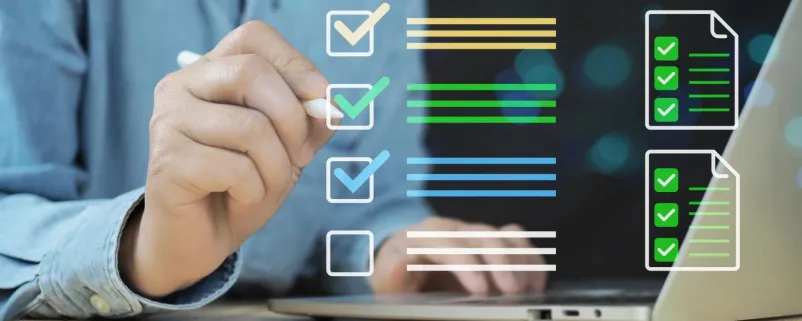
Entscheidungen in der Verwaltung müssen nachvollziehbar und überprüfbar sein – KI-Systeme erzeugen jedoch oft eine ‚„Black Box“.
© Bird Photographer TH - stock.adobe.com
Digitalisierung
KI in der öffentlichen Verwaltung: Zwischen Effizienzpotenzial und Ressourcenverschwendung
Die Diskussion rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der öffentlichen Verwaltung Österreichs hat in den vergangenen Jahren wesentlich an Dynamik gewonnen. Während einerseits Effizienzsteigerungen, Transparenz und eine verbesserte Bürger:innennähe versprochen werden, sind andererseits erhebliche Risiken in Bezug auf Nachhaltigkeit, Ressourcenverbrauch und rechtlich- ethische Herausforderungen erkennbar. Dieser kompakte Beitrag analysiert sowohl Chancen als auch Risiken, zeigt mögliche Anwendungsfelder auf und reflektiert die Notwendigkeit einer kritischen Abwägung im österreichischen Verwaltungsapparat.
Ein zentrales Versprechen von KI liegt in der Effizienzsteigerung. Zahlreiche Routinetätigkeiten in der Verwaltung (wie z. B. die Bearbeitung standardisierter Anträge, das Auslesen von Dokumenten oder die automatisierte Beantwortung von Bürger:innenanfragen) können durch KI-Systeme beschleunigt werden. Dies führt nicht nur zu einer Reduktion von Bearbeitungszeiten, sondern eröffnet auch die Möglichkeit, Verwaltungsmitarbeiter:innen von repetitiven Tätigkeiten zu entlasten und stärker für komplexe Aufgaben, die menschliches Ermessen erfordern, einzusetzen.
Potenziale von KI in der öffentlichen Verwaltung
Gerade mit Blick auf den Public Sector in Österreich, wo eine Vielzahl von Verwaltungsprozessen durch gesetzlich normierte Abläufe und Formularwesen geprägt ist, bieten KI-Anwendungen das Potenzial, Prozesse zu vereinfachen und Bürger:innen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen zu ermöglichen.
Ein Beispiel sind Chatbots, die Anfragen rund um Meldepflichten oder Förderansuchen rund um die Uhr beantworten können. Darüber hinaus könnte KI im Bereich der Datenanalyse neue Möglichkeiten eröffnen.
Durch die Auswertung großer Datenmengen können Trends frühzeitig erkannt, Prognosen für die Infrastrukturplanung erstellt oder Risiken (beispielsweise im Umwelt- und Katastrophenschutz) präziser eingeschätzt werden. Damit wird die Entscheidungsgrundlage für politische und verwaltungstechnische Maßnahmen gestärkt.
Von besonderer Relevanz ist in diesem Zusammenhang auch das neue Informationsfreiheitsgesetz (IFG), das mit 1. September 2025 in Kraft getreten ist. Es verpflichtet die Verwaltung zur proaktiven Offenlegung zahlreicher Informationen und löst damit das bisherige Amtsgeheimnis in weiten Teilen ab. KI kann hier einen wesentlichen Beitrag leisten, indem sie Verwaltungsdokumente automatisiert kategorisiert, prüft und für die Veröffentlichung aufbereitet. Auf diese Weise können Transparenzpflichten schneller erfüllt und Bürger:innen ein leichterer Zugang zu staatlichen Informationen ermöglicht werden.
Rechtliche und ethische Herausforderungen
Die Implementierung von KI-Systemen in der Verwaltung wirft jedoch auch grundlegende Fragen auf. Eine zentrale Herausforderung betrifft das Rechtsstaatsprinzip: Entscheidungen in der Verwaltung müssen nachvollziehbar und überprüfbar sein. KI-Systeme, insbesondere solche, die auf komplexen Machine-Learning-Algorithmen basieren, können jedoch eine „Black Box“-Problematik erzeugen, da Entscheidungsprozesse nicht immer transparent dargelegt werden können.
Außerdem stellt sich im Speziellen die Frage nach der Verantwortlichkeit. Sollte eine KI eine fehlerhafte Entscheidung treffen (z. B. eine unberechtigte Ablehnung eines Förderantrags), so muss klar geregelt sein, ob die Verantwortung bei der Verwaltung,dem Systemanbieter oder den Entwicklern liegt. Österreichische Verwaltungsgerichte werden sich früher oder später mit solchen Fragestellungen auseinandersetzen müssen.
Auch datenschutzrechtliche Aspekte sind nicht zu vernachlässigen. Da viele Verwaltungsverfahren personenbezogene Daten betreffen, ist die Vereinbarkeit von KI-Anwendungen mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sicherzustellen. Rechtskonforme Anonymisierungen, Verarbeitungen und Speicherungen von Daten stellen in der Praxis häufig erhebliche Hürden dar.
Verwaltungsethik als Leitlinie für den KI-Einsatz
Neben juristischen Aspekten wird die Frage nach Ethik im Verwaltungshandeln zunehmend bedeutsam. Ethik ist im Umgang mit KI kein bloßes „Nice to have“, sondern eine notwendige Grundlage, um Vertrauen und Legitimität im öffentlichen Sektor sicherzustellen.
Besonders im Umgang mit KI bedeutet Verwaltungsethik, sich mit Fragen von Fairness, Diskriminierungsfreiheit und Transparenz auseinanderzusetzen (vgl. Possard, Verwaltungsethik im Fokus, 2025). Während Technologie allein Effizienzsteigerung verspricht, kann sie ohne klare ethische Leitlinien ungewollt bestehende Ungleichheiten reproduzieren oder sogar verstärken. Verwaltungsethik stellt damit sicher, dass KI-Systeme nicht nur technisch, sondern auch normativ in den Dienst des Gemeinwohls gestellt werden.
Nachhaltigkeit und die Gefahr der Ressourcenverschwendung
Neben rechtlichen Fragen ist auch die Nachhaltigkeit des KI-Einsatzes kritisch zu reflektieren. KI-Systeme sind nicht nur in der Entwicklung und Implementierung kostenintensiv,sondern verursachen auch im Betrieb hohe Energieaufwände (vor allem in Bezug auf rechenintensive Modelle). Der ökologische Fußabdruck von KI darf daher nicht außer Acht gelassen werden, wenn öffentliche Mittel im Sinne der Nachhaltigkeit und des Gemeinwohls eingesetzt werden sollen. Hinzu kommt das Risiko der Ressourcenverschwendung durch unreflektierte Pilotprojekte.
Häufig werden KI-Systeme eingeführt, ohne& dass eine nachhaltige Strategie vorliegt. Dies kann zu „technologischen Insellösungen“ führen, die nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden müssen, weil Wartung, Akzeptanz oder rechtliche Absicherung fehlen. Solche Entwicklungen binden nicht nur finanzielle Mittel, sondern untergraben auch das Vertrauen von Bürger:innen und (Verwaltungs-)Mitarbeiter:innen in digitale Verwaltungsinnovationen.
Fazit: Balance zwischen Innovation und Verantwortung
Was bedeuten die hervorgeheben Chancen und Risiken nun also für die Praxis?
Um den Mehrwert von KI für die Verwaltung in Österreich auszuschöpfen, bedarf es in Summe einer sorgfältigen Balance zwischen Innovationsfreude und Verantwortungsbewusstsein. Dies erfordert klare Strategien, Pilotprojekte mit wissenschaftlicher Begleitung sowie die Einbettung von KI in eine übergeordnete Digitalisierungsstrategie.
Besonders wichtig ist die Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsmitarbeiter:innen: Nur wenn diese die Funktionsweise und Grenzen von KI verstehen, können Systeme sinnvoll genutzt und Missbrauch oder Fehlentscheidungen vermieden werden. Eine sogenannte „KI-Kompetenz“, also ein rechtliches, ethisches und technisches Grundverständnis im Umgang mit KI, fordert der EU AI Act gemäß Artikel 4 von KI-Anwender:innen, die KI-Systeme beruflich nutzen, bereits explizit ein.
In Zukunft wird die verstärkte Einbindung von Jurist:innen und Ethiker:innen von zentraler Bedeutung sein. Fragen betreffend die Grundrechte, die Diskriminierungsfreiheit und die Nachvollziehbarkeit dürfen nicht nachträglich, sondern müssen von Beginn an in die Konzeption von KI-Projekten einbezogen werden.
Der Einsatz von KI in der österreichischen Verwaltung bewegt sich zusammenfassend zwischen dem Versprechen erheblicher Effizienzgewinne und der Gefahr einer ressourcenintensiven und nicht nachhaltigen Fehlentwicklung.
Einerseits können KI-Systeme Verwaltungsvorgänge beschleunigen, Transparenz fördern und Bürger:innen einen niederschwelligen Zugang zu staatlichen Leistungen eröffnen, andererseits bestehen jedoch erhebliche rechtliche, ethische und ökologische Herausforderungen. Nur durch eine Balance zwischen technologischer Machbarkeit, ethischer Reflexion und verantwortungsvoller Governance kann sichergestellt werden, dass KI tatsächlich einen Beitrag zum öffentlichen Interesse leistet – und eben nicht zur Verschwendung knapper Ressourcen führt.