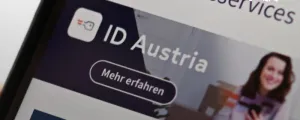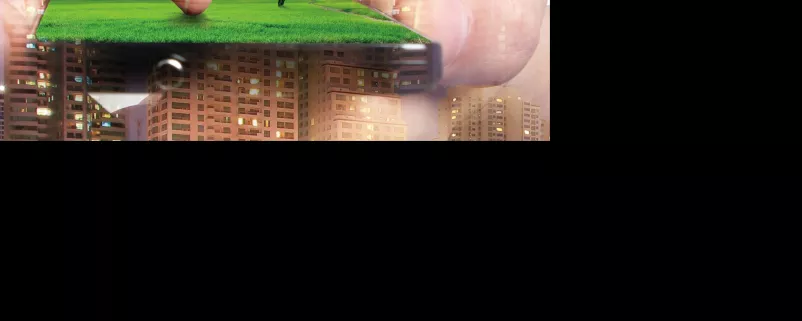
© Shutterstock.com/sippacom
Erste Smart Village-Projekte zeigen Erfolge
Der Müllwagen zeigt Fehlwürfe an, Sensoren in der Fahrbahndecke warnen vor Glatteis und Räumfahrzeuge tracken selbst, wo im Stadtgebiet bereits geräumt und wo noch ein Einsatz nötig ist. Feldkirchen und Riegersburg in der Steiermark sind die ersten Smart Villages Österreichs.
Innovation muss beim Bürger ankommen, und dafür braucht es eine mutige Gemeindevertretung“, sagt Erich Gosch, Bürgermeister von Feldkirchen. Energie Steiermark, Saubermacher und die beiden Gemeinden arbeiten seit fast einem Jahr in einer Pilotphase daran, verschiedene kommunale Aufgaben durch modernste Technik zu optimieren.
„Die Steiermark ist ein Innovationsland“, sagt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bei der Präsentation der Zwischenergebnisse am Gemeindetag in Graz. „Mit den Smart Villages zeigen wir, wie Digitalisierung Umweltschutz und Nachhaltigkeit fördern kann.“
Ein Wertstoffscanner erkennt in beiden Gemeinden, wie viele Fehlwürfe es im Restmüll gibt. Sensoren scannen den Müll, während er aus der Tonne in den Müllwagen geladen wird.
Zu Beginn erkannten die Scanner in 65 Prozent aller Mülltonnen Fehlwürfe. Schon durch die Ankündigung, dass der Müll nun überprüft wird, habe sich die Quote auf 38 Prozent verringert. Durch gezielte Informationen konnte sie in der Folge noch weiter gesenkt werden.
Infos über Müllabholung per App
Zur Kommunikation werden SMS und die App „Daheim“ benutzt. Über die App informieren die Städte ihre Bürger über die nächste Abholung und geben Tipps zur Mülltrennung, die auf den Daten beruhen, die beim Scannen gesammelt wurden. „Die Bürger haben das Angebot gut angenommen. Alle wollten dabei sein“, erzählt Manfred Reisenhofer, Bürgermeister von Riegersburg.

Nun setzt man auch im Kärntner Villach die Wertstoffscanner ein. Derzeit sind die Scanner noch im Testbetrieb, doch für 2020 wird eine Region für den Normalbetrieb gesucht.
Mit GPS-Streckenerfassung sind die Kommunalfahrzeuge in Feldkirchen und Riegersburg ausgestattet. So erhalten die Gemeinden einen Überblick darüber, wo etwa bereits geräumt ist. „Das ist bei uns sehr wichtig, um die Sicherheit im Winter gewährleisten zu können“, sagt Bürgermeister Reisenhofer.
Eissensoren auf der Fahrbahn
Ebenfalls wichtig für den Winterdienst sind die Eissensoren, die an neuralgischen Punkten in die Fahrbahndecke eingelassen sind. Mithilfe künstlicher Intelligenz lernen die Sensoren über Temperaturmessungen der Luft und des Straßenbelags zu erkennen, wann Glatteisgefahr besteht und wann Schnee liegen könnte.
„Früher mussten wir an den kritischen Punkten Mitarbeiter vorbeischicken, die die Situation überprüft haben“, erzählt Reisenhofer. „Die Sensoren bedeuten deshalb eine große Kostenersparnis.“ Und auch Streugut kann durch die Sensoren gespart werden, denn es wird nur noch dort gestreut, wo tatsächlich Schnee und Eis die Sicherheit gefährden.