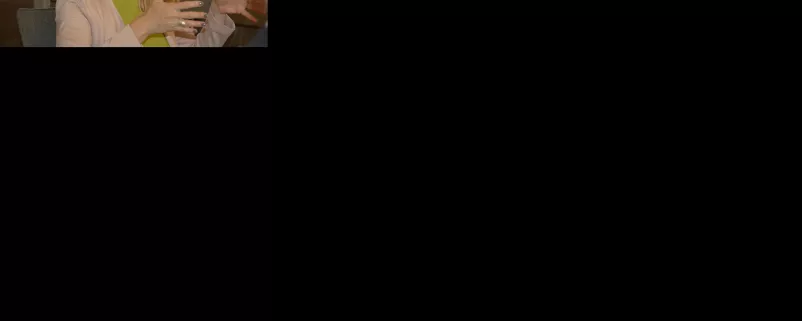
Margarete Schramböck: „Es geht uns auch darum, dass wir Anwendungen online stellen, die den Gemeinden in ihrer Arbeit hilft.“
„Das digitale Amt soll die Gemeinden entlasten“
Die Digitalisierung von Verwaltung und Gesellschaft, ein Standortentwicklungsgesetz und ein neuer Beruf – zu diesen Themen antwortete Mitte Juni Margarete Schramböck im KOMMUNAL-Interview. Eines wurde dabei schnell klar: Den Gemeinden kommt mehrfach eine eminent wichtige Rolle zu.
Die Wirtschaft hat derzeit vor allem Themen wie die künstliche Intelligenz, die Blockchain, Quantencomputer, Augmented Reality, autonomes Fahren, oder das Internet of Things im Fokus. Die Politik in Europa versucht die Entwicklungen auf diesen Gebieten mit einer Datenschutzgrundverordnung etwas einzudämmen – zumindest ist das unser Eindruck. Die Realitäten in den Kommunen sind aber noch ganz andere. Wie sehen Sie das?
Margarete Schramböck: Wir arbeiten am Thema der „digitalen Kluft“. Die digitale Verwaltung muss viel selbstverständlicher werden. Ich meine damit Abläufe in der Verwaltung, die digitalisiert werden müssen, also übers Internet verfügbar werden. Die Gemeinden sind da nicht ausgeschlossen, sie spielen sogar ein sehr wichtige Rolle. Uns geht es darum, von der Abarbeitung der Routinetätigkeiten weg und zu beratenden und unterstützenden Tätigkeiten hinzukommen. Deswegen entwickeln wir Plattformen wie oesterreich.gv.at, von dem demnächst eine Erstversion präsentiert werden soll. Ganz fertig ist sowas ja nie. Auf dieser Plattform werden unter anderem die Dienste von help.gv.at oder dem Unternehmensserviceportal gebündelt.
Der erste Fall, der abgebildet wird, ist die Geburt eines Kindes. Alle Abläufe, die bei der Geburt wichtig sind – Geburtsurkunde, Meldezettel, Staatsbürgerschaftsnachweis – sollen über die Plattform oesterreich.gv.at beziehungsweise über eine App laufen. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen dann nirgends mehr hingehen, um sich um Dokumente anzustellen. Die Dokumente sollen stattdessen sozusagen zu den Menschen kommen. Dieses digitale Amt, das Durcharbeiten durch die unterschiedlichsten Behördengänge, soll auch die Gemeinden entlasten.
Wir reden hier von Bundesservices, die digitalisiert werden sollen. Umgesetzt soll das in den Kommunen werden. Wie wollen Sie die Städte und Gemeinden mitnehmen?
Sehr viele Gemeinden und Länder, angefangen bei Wien, haben schon eigene Applikationen entwickelt. Unser Anliegen ist es natürlich, dass wir diese Apps integrieren oder verbinden.
Wir müssen das Rad ja nicht immer neu erfinden. Es gibt viele Dienste von Ländern – und sicher auch von Gemeinden – die wir einbinden könnten. Es geht uns auch darum, dass wir Anwendungen online stellen, die den Gemeinden in ihrer Arbeit hilft. Gerade die Gemeinden haben immer mehr Themen und wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden auch freispielen, damit sie Zeit gewinnen.
Heißt das, dass sie für Gemeinden Applikationen entwickeln?
Wir würden zuerst einmal den Bedarf erheben, was die Gemeinden aktuell brauchen. Wenn wir das einmal wissen, können wir Lösungen in die betreffende Applikation, die ja schon vorhanden ist, oder ins Portal einarbeiten.
Aber wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, für die Gemeinden Software zu entwickeln. Wir stellen unsere Plattform oesterreich.gv.at zur Verfügung, damit die Gemeinden ihre Services integrieren können. Damit wollen wir das Leben für die Menschen vor Ort und die Wirtschaft vor Ort erleichtern.

Für die Digitalisierung sollen in den kommenden fünf Jahren zusätzlich 100 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Wie viel davon ist für die Gemeinden?
Das ist ein Gesamtbudget für das Thema. Es geht nicht darum, dass wir den Gemeinden etwas zur Verfügung stellen, es gibt keinen Budgettransfer.
Was wir tun können, ist genau jene Dienstleistungen zu entwickeln oder zu bauen, die die Gemeinden brauchen und damit die Gemeinden entlasten. Also zum Beispiel, wenn heute ein mittelständisches Unternehmen für das Finanzamt eine Steuer abführen will, müssen alle möglichen Formulare ausgefüllt werden. Es kommt sehr oft vor, dass sich solche Firmen an die Gemeinden wenden, weil sie die Vorgänge nicht genau genug kennen. Und wir sehen unsere Aufgabe dahingehend, dass diese Firmen die Informationen nur einmal zur Verfügung stellen müssen. Unsere Kunden sind die Unternehmen und damit indirekt auch die Gemeinden.
Bei der Digitalisierung der Verwaltungsebene fallen auch Schlagwörter wie Blockchain, Chatbots oder Artificial Intelligence. Was genau sollen die Gemeinden und Städte davon einsetzen?
Diese Lösungen sind ja bei etlichen Unternehmen schon im Einsatz. Wir können jetzt überlegen, wie wir das für unsere Bedürfnisse adaptieren und dann dort einsetzen, wo Gemeinden einen Vorteil haben.
Wir analysieren gerade die Daten, deshalb kann ich derzeit noch keinen Bereich nennen, für den auf kommunaler Ebene Künstliche Intelligenz einsetzbar wäre.
Blockchain ist ein weiteres Schlagwort. Hier sollen Daten besser abgesichert und verfügbar sein. Spießt sich das nicht mit der Datenschutzgrundverordnung?
Um eines ganz klar zu machen: Ich will keine Bürgerdaten in der Blockchain!
Wir haben ein sehr klares Registersystem in Österreich, wo die Daten der Bürgerinnen und Bürger sind – worüber wir im Übrigen von vielen Ländern beneidet werden. Und das wird so bleiben. Wir werden die Register auch getrennt lassen – es wird aber die Frage zu klären sein, wie der Austausch zwischen den Registern erfolgen wird.
Also: Keine Bürgerdaten in der Blockchain. Aber wir sollten uns überlegen, wie wir die Technologie nutzen können, um künftig bestimmte Dienste nutzen zu können. Das ist aber erst in der Entwicklung.
Estland ist mit Anwendungen wie e-Voting und dem virtuellen Bürger führend in der Digitalisierung Europas. Ist Estland ein Vorbild für Österreich?
Sie sind ein Vorbild, weil sie viele Dinge gut umgesetzt haben. Allerdings gehen sie von anderen Voraussetzungen aus. Estland ist einwohnermäßig so groß wie Wien und kann daher eine IT für das ganze Land einfacher umsetzen. Und sie haben sozusagen auf der grünen Wiese begonnen – was ein großer Vorteil sein kann.
Wir sind zwar sehr gut gestartet, sind dann aber leider eingeschlafen. Wir sind bei den Behördendiensten auf Platz 5 in Europa, was wirklich nicht schlecht ist. Doch in anderen Bereichen, wie beispielsweise der digitalen Kompetenz, liegen wir leider viel weiter hinten.
Unser Ziel ist es, dass in Österreich jeder, der das auch möchte, eine digitale Identität haben kann und diese dann auch nutzen kann, sofern er das will.
Ende April haben Sie in einem Standard-Interview einen Entwurf für ein Standortentwicklungsgesetz präsentiert. Es soll Anfang 2019 in Kraft treten. Wie sehen die Eckpunkte des Entwurfs aus?
Ziel des Gesetzes ist, Verfahren für Projekte zu beschleunigen, die für den Standort von wesentlicher Bedeutung sind. Die Eckpunkte sind im Gesetz so definiert, dass man ein Projekt und einen Prozess identifizieren kann. Ein Prozess könnte so aussehen, dass beispielsweise eine Gemeinde einem Bundesland ein großes und für die Gemeinde wichtiges Projekte vorschlägt. Dieses Projekt wird dann in einem Expertengremium begutachtet und der Landesregierung vorgelegt. Diese entscheidet, ob das Projekt übernommen wird oder nicht.
Bei diesen Projekten geht es meist um große Infrastrukturprojekte, die für den Standort Österreich von Bedeutung sind.
Wie sind die Gemeinden da eingebunden, die ja die Standorte sind? Oder ist der Gemeindebund als Dachorganisation eingebunden?
Das wäre zu früh, jetzt über die Zusammensetzung des Gremiums zu reden, weil wir gerade in der Ausarbeitung sind.
Wie würde denn ein Szenario aussehen, wenn eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden gegen ein Projekt sind?
Es wird immer welche geben, die mit einem Projekt nicht einverstanden sind. Dafür gibt es den Verfahrensweg, wo man Einspruch erheben kann, wenn man Parteienstellung hat. Auch die Umweltverträglichkeitsprüfung wird es weitergeben.
Was aber passieren wird ist, dass sich die Geschwindigkeit erhöht. Die Zeiträume, innerhalb derer Entscheidungen getroffen werden müssen, werden gestrafft. Vor allem, um Rechtssicherheit zu kreieren, sowohl für Befürworter als auch für Gegner. In diesen Verfahren sind ja unheimlich viele Ressourcen gebunden. Wenn sie sich beispielsweise den Stadttunnel in Feldkirch ansehen, wie lange das dauert. Und jetzt sind die Gutachten veraltet und man muss wieder von vorne anfangen. Das wollen wir verhindern.
Gerade aus der Wirtschaft gibt es wenig Verständnis dafür, warum besonders öffentliche Projekte so lange dauern.
Was sind denn die Gründe für diese Verzögerungen?
Das hat zum Teil mit dem Gutachter- und Sachverständigenwesen zu tun, wo es oft zu einem Engpass kommt.
Es gibt auch immer wieder Einsprüche durch verschiedenste Gruppen, die oft mit dem Projekt direkt gar nichts zu tun haben. Einsprüche sollten nur mehr jene erheben können, die aus der Region sind und die unmittelbar betroffen sind. Das ist jetzt nicht so.
Zum Bereich „Standortpolitik“ gibt es eine eigene Förderung, allerdings nur für Unternehmen. Sollten Gemeinden da nicht auch „förderwürdig“ sein? Etwa für Infrastrukturmaßnahmen im Sinne des Standortes?
Über die Forschungsförderungsgesellschaft FFG schon. Da gibt es unterschiedliche Förderbereiche, beispielsweise die angewandte Forschung. Das ist vordergründig zwar für die Gemeinden eher nichts, aber wenn man in seiner Gemeinde ein Christian-Doppler-Institut hat, ist das ein großer Mehrwert für die Kommune.
Über die FFG gibt es auch Förderungen für die Infrastruktur, beispielsweise für den Breitbandausbau. Das ist ja eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Gemeinden, Unternehmen anzusiedeln oder zu halten. Das ist ein ganz wichtiger und prioritärer Punkt.
Die Ausschreibungsbedingungen sind allerdings oftmals zu kompliziert. Und es gibt Kritik, dass es offenbar keinen „übergeordneten Plan“ für den Breitbandausbau gibt.
Ich spreche jetzt zwar fürs Infrastrukturministerium, aber aufgrund der engen Zusammenarbeit kann ich eines sagen: Derzeit wird an einer Überarbeitung des Telekommunikationsgesetzes gearbeitet, vor allem um den 5G-Ausau zu forcieren. So ist beispielsweise das gemeinsame Nutzen eines Netzwerks – das sogenannte Network-sharing – derzeit nicht vorgesehen. Das ist aber ein wichtiger Punkt um möglichst rasch in Regionen, die nicht so profitabel erschlossen werden können, vorzudringen.
Zweitens wird der Breitbandatlas derzeit digital neu erstellt. So ein Atlas lebt ja und muss ständig aktualisiert werden und deshalb brauchen wir Transparenz darüber, wo wer was ausbaut. Das haben wir derzeit nicht. Daher wissen wir auch nicht, wo wir konkret welche Maßnahmen setzen müssen.
Und drittens arbeiten wir an einer neuen Ausschreibung für 5G. Ganz wichtig ist, dass hier eine Regionalisierung vorgesehen wurde – das ist zwar nicht für einzelne Gemeinden, aber für Gemeindeverbünde oder auch für Länder oder für regional tätige Unternehmen. Das gab’s früher nicht, ist aber jetzt vorgesehen.
5G ist für die Gemeinden wichtig, weil es einen Technologiesprung darstellt. Glasfaseranschlüsse sind auch wichtig – und daher teilen wir die Anforderungen. Einen abgelegenen Hof erreichen wir über eine gute Mobilanbindung genauso. Gerade im mobilen Internet ist Österreich europaweit Vorreiter und wir schließen damit die Kluft zwischen Stadt und Land.
Kommen da die Gemeinden nicht wieder mit ihrer Infrastruktur – beispielsweise die Ortsbeleuchtung – ist Spiel. Moderne Leuchten wären ja für bereit für die 5G-Technologie. Wären da nicht Gemeinden der Ansprechpartner?
Die Gemeinde wird beim Ausbau von 5G ein ganz wichtiger Partner werden. Es wird von der Geschwindigkeit der Genehmigungen und den Möglichkeiten, die die Bürgermeister bieten, abhängen, ob in der Gemeinde 5G da ist oder nicht.
Letzte Frage: In Ihren Bereich fällt auch die Lehrlingsausbildung. Für den Bereich Pflege wurde in den vergangenen Monaten rund um die Debatte zum Wegfall des Regresses und der notwendigen Neuausrichtung der Pflege in Österreich immer wieder ein echter „Lehrberuf Pflege“ bzw. ein „Berufsbild Pfleger/Pflegerin“ gefordert. Wie stehen Sie zu solchen Vorschlägen?
Ich sehe das sehr positiv. Ich will da allerdings dem Sozialministerium nicht vorgreifen, die hier für die Inhalte verantwortlich zeichnen. Derzeit überarbeiten wir ja die Lehrberufe. Hier schließt sich wieder der Kreis zur Digitalisierung, weil wir in der Ausbildung für die Lehrberufe die digitale Kompetenz weiter vermitteln müssen. Sogar ein Lehrberuf wie Orgelbauer braucht eine digitale Kompetenz – moderne Orgeln werden heute per Fernwartung gewartet.
Mein Ziel ist, dass für jeden Beruf – einen alten wie Maurer oder Mechaniker, aber auch einen neuen wie der Pflege – eine digitale Ausbildungsmöglichkeit gegeben ist.










