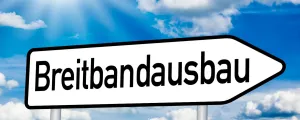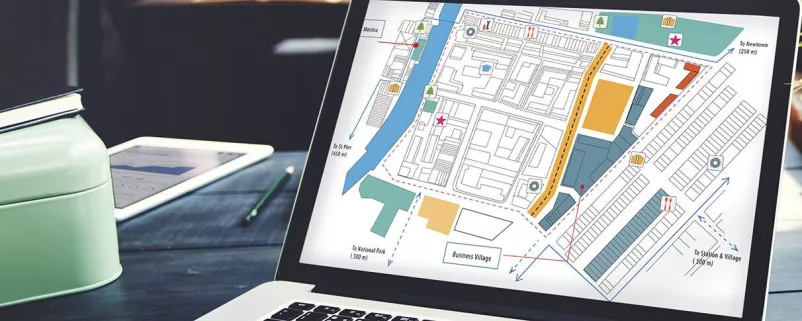
Auf kommunaler Ebene müssen neue Instrumente genutzt werden, die durch die Forcierung von Innovation direkt zu Wachstum und Beschäftigung beitragen. Foto: Shutterstock
Neue Herausforderungen für die kommunale Infrastruktur
Die demografische Entwicklung sowie der strukturelle Wandel in Richtung immer wissens- und technologie-intensiverer Produktion stellt die Infrastruktur in den Regionen und Gemeinden vor enorme Herausforderungen. Woran aber forscht die Wissenschaft derzeit, und welche Handlungsempfehlungen lassen sich daraus ableiten?
Infrastruktur ist nichts anderes als die Grundausstattung eines Landes, einer Region oder einer Kommune, also die Basis für jedes soziale und wirtschaftliche Handeln. Das sind zum einen Straßen, Stromnetze, Telekommunikationseinrichtungen, Schienen, also langlebige Einrichtungen materieller Art, die das Funktionieren einer arbeitsteiligen Wirtschaft ermöglichen, die beispielsweise Erreichbarkeit garantieren und Kommunikation erst ermöglichen. Die Sicherstellung von Versorgungssicherheit steht hier im Vordergrund der Überlegungen. Die Verfügbarkeit von Infrastruktur sichert Mobilität (Straßen, Bahn, Flughäfen etc.), es werden öffentliche Güter geschaffen, welche unter rein marktwirtschaftlichen Bedingungen nicht verfügbar wären.
Zum anderen hat Infrastruktur immer einen institutionellen, also einen sozialen Aspekt. Die in einer Region, einer Gemeinde ansässigen gesellschaftlichen Institutionen, beispielsweise Behörden, Gerichte, Universitäten und Schulen (das Bildungssystem) zählen zur Infrastruktur. Es werden soziales Verhalten sowie Aktivitäten von Individuen und Gruppen gelenkt, geformt oder erst ermöglicht. Der Begriff Infrastruktur umfasst somit mehrere Dimensionen, also weit mehr als „materielle Güter“. Zudem hat sich die Definition, aber auch das Verständnis um die Relevanz von Infrastruktur in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt – die soziale Dimension von Infrastruktur gewinnt an Relevanz und wird zunehmend eine zentrale Determinante der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen. Mehrere sich gegenseitig beeinflussende und sich zum Teil verstärkende Entwicklungen verändern die Ansprüche, die wir gegenwärtig an Infrastruktur haben: erstens der demografische Wandel, zweitens eine zunehmende Konzentration von Wohn- und Arbeitsregionen sowie drittens die möglichen Auswirkungen der Digitalisierung oder der vierten industriellen Revolution (Industrie 4.0).
Regionen an der Peripherie drohen auszusterben
Im Zuge des demografischen Wandels werden die regionalen Disparitäten weiter steigen, urbane Zentralräume entwickeln sich äußerst dynamisch und wachsen, gleichzeitig sehen sich zahlreiche periphere Regionen mit einer schrumpfenden Einwohnerzahl und alternden Bevölkerung konfrontiert. Viele Regionen beziehungsweise Kommunen stehen vor weitreichenden neuen Herausforderungen – gerade was ihre Infrastruktur betrifft. Die direkten Effekte auf die kommunale Infrastruktur werden erheblich sein und weitreichendere Folgen haben. Der kommende Anpassungsbedarf, die Kosten der (notwendigen) Investitionen in Infrastruktur lassen sich kaum abschätzen, wobei auch der Rückbau, die Re-Dimensionierung von Infrastruktur in schrumpfenden Regionen kostspielig ist und sein wird.
Eine Herausforderung im Bereich Demografie ergibt sich aus einer sich deutlich abzeichnenden strukturellen Verschiebung. Zum einen werden die Österreicherinnen und Österreicher im Durchschnitt immer älter, zum anderen kommt es zu einem weiteren Konzentrationsprozess.
Im Wesentlichen prägen zwei Trends die demografische Zukunft Österreichs und seiner Regionen: Erstens, die Lebenserwartung steigt stetig – bis zum Jahr 2030 werden Frauen durchschnittlich 86,8 Jahre alt werden, Männer immerhin 82,3 Jahre. Gleichzeitig ist die Geburtenrate seit Mitte der 1960er rückläufig und stagniert seit Mitte der 1990er-Jahre zwischen 1,4 und 1,5 Kindern pro Frau. Für eine stabile Bevölkerung werden mindestens 2,1 Kinder pro Frau benötigt.
Zweitens konzentriert sich das Bevölkerungswachstum auf einige wenige städtische Agglomerationen und auf (angrenzende) Kommunen im weiteren Einzugsgebiet dieser Zentralräume. So prognostiziert die Österreichische Raumordnungskonferenz nur einigen wenigen von insgesamt 122 Prognoseregionen bis 2030 ein starkes Bevölkerungswachstum. Die Dynamik wird fast ausschließlich vom Großraum Wien, der sich bis ins Nordburgenland zieht, und von Graz, Salzburg, Innsbruck und Bregenz sowie dem oberösterreichischen Zentralraum Linz-Wels getrieben. Für die meisten peripheren Regionen wird ein deutlicher Bevölkerungsrückgang erwartet, etwa in der Kärntner Peripherie und in der obersteirischen Mur-Mürz-Furche. Spitzenreiter ist hier der Bezirk Murau mit –11,3 Prozent. Insgesamt ist ein deutlicher Konzentrationsprozess zu beobachten – internationale Zuwanderung konzentriert sich auf die urbanen Regionen rund um Wien, Graz, Salzburg, Linz etc. Rund 48 Prozent der Zuwanderer aus dem Ausland sind zwischen 20 und 35 Jahre alt.
Zudem wandern junge Menschen aus den Regionen vor allem in die Städte und ihr Umfeld – der Speckgürtel wächst. Rund 43 Prozent aller Binnenwanderungen entfallen auf Menschen im Alter von 20 bis 35 Jahren. 20- bis 24-Jährige wandern am häufigsten – rund 24 Prozent aller Einwohner dieser Kohorte wechseln innerhalb eines Jahres ihren Wohnort.
Mit zunehmendem Alter sinkt der Anteil der Wanderer in den Altersgruppen. Bei Menschen über 74 Jahren setzt ein weiterer (altersbedingter) Wanderungsprozess ein – steigende Pflegebedürftigkeit verlangt andere Wohn- und Lebenswelten. Es kommt zu einer Nachfrage- veränderung, die Konsumausgaben für Wohnen und Gesundheit steigen, zusätzliche Pflegeeinrichtungen müssen geschaffen werden. Die eigentliche Herausforderung, das eigentliche Problem, ergibt sich weniger aus dem Bevölkerungsschwund, vielmehr ist das Wegbrechen des Erwerbspotenzials, also der Bevölkerung im Erwerbsalter zwischen 20 und 64 Jahren, das zentrale Problem. Schrumpfende Regionen werden schlicht nicht über ein ausreichendes Humankapital verfügen. So wird nur in 47 der 122 Prognoseregionen eine Steigerung des Erwerbspotenzials erwartet. Das Erwerbspotenzial steigt vor allem in den Städten, in den urbanen Agglomerationen, in den peripheren Regionen wird die Zahl der 20- bis 64-Jährigen weiter sinken – Spitzenreiter ist hier wiederum der Bezirk Murau mit –22,5 Prozent. Kurzum Regionen an der Peripherie drohen auszusterben, die Unternehmen in der Region werden ihr Arbeitskräftepotenzial kaum mehr aus der Region schöpfen können.
Hohe Strahlkraft der Städte
Zudem zeichnet sich ein weiterer Trend ab, der direkt auf die kommunalen Infrastrukturen wirkt und im Speziellen die kommunale Ebene betrifft. Arbeitsplätze werden nicht notwendigerweise in solchen Regionen geschaffen, die sich demografisch äußerst dynamisch entwickeln. In vielen urbanen Agglomerationen wächst die Bevölkerung weit stärker als die Zahl der Arbeitsplätze.
Die durch die interregionale und internationale Zuwanderung äußerst dynamische Bevölkerungsentwicklung übt einen hohen Druck auf den Arbeitsmarkt aus, etwa in Wien und in Graz. Es werden nicht genügend Jobs für die stetig wachsende Einwohnerzahl geschaffen. Dies gilt in besonderem Maße für Niedrigqualifizierte. Es kommt zu einer auf den ersten Blick paradox wirkenden Situation. Manche peripheren Regionen werden Bevölkerung verlieren - und das, obwohl in den Regionen Arbeitsplätze geschaffen werden und überdurchschnittlich hohe Löhne bezahlt werden. Dies ist heute beispielsweise schon in einigen obersteirischen Industrieregionen der Fall. Die Strahlkraft der Städte ist weit höher, als noch vor ein paar Jahren angenommen. Ein dynamischer Arbeitsmarkt und hohe Löhne reichen manchmal nicht aus, um moderierend auf den demografischen Wandel zu wirken.
Diese Entwicklung hat mehrere Ursachen: Zum einen wurde das Beschäftigungswachstum der vergangenen Jahre zu einem guten Teil von einer Steigerung der Erwerbsquote bei Frauen getragen. Hier ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zentraler Faktor – und die hierfür relevanten Einrichtungen, die Infrastruktur, fehlen in peripheren Regionen oftmals.
Zum anderen konzentriert sich die Bildungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsinfrastruktur, aber auch die Forschungsinfrastruktur auf die urbanen Agglomerationen. Die Konzentration von Infrastruktur ist ein weiterer Treiber des demografischen Wandels. In jedem Fall muss eine wirkliche Entlastung der Arbeitsmärkte in den Städten und eine ausgewogene endogene Regionalentwicklung in den Regionen beziehungsweise in den peripheren Kommunen angestrebt werden, was nur über verstärkte interregionale Kooperationen und eine Verbesserung der Erreichbarkeiten gelingen kann – dies erfordert aber wiederum Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in den öffentlichen Verkehr, und letztlich eine abgestimmte überregionale Raumplanung.
Fakt ist, dass die Zahl der Pendler kontinuierlich steigt und weiter steigen wird. Infrastruktur ist „ein endogener Potenzialfaktor für die regionale Entwicklungsfähigkeit“ (Jochimsen 1995). Damit das endogene Potenzial einer Region also ausgeschöpft werden kann, bedarf es einer leistungsfähigen Verkehrs-, Logistik- und Mobilitätsinfrastruktur, im Wesentlichen Straße und Schiene, im Ballungsraum auch Fluganbindungen. Mobilitätshemmnisse an sich können sich direkt auf die Arbeitslosigkeit auswirken, insbesondere in Bereichen mit einem geringen Durchschnittseinkommen. In anderen Worten: Wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sind eng mit Investitionen in Infrastruktur verbunden. Diese profitieren überproportional von einer Verbesserung der regionalen und interregionalen Erreichbarkeiten.
Verbesserte Erreichbarkeiten erleichtern Pendlerbewegungen. Die Reisezeit zwischen zwei Regionen wird verkürzt. Die Alternative zum Pendeln ist „Wandern“ – die Menschen verlassen die Region aufgrund fehlender Infrastruktur, langer Fahrtwege etc. Ein kausaler Zusammenhang zwischen Infrastruktur und Wachstum liegt in der Dynamik des Arbeitsmarktes. Die zentrale Frage lautet: Wenn neue Stellen am Arbeitsmarkt geschaffen werden, wo kommen die Arbeitskräfte her, welche diese freien Stellen besetzen, und welche Dynamik entsteht dadurch am Arbeitsmarkt?
Regionen müssen Arbeitskräfte aus Städten anziehen
Es zeigt sich, dass neue Arbeitsplätze vermehrt von Beschäftigten aus der eigenen Branche besetzt werden. Somit droht ein Verdrängungswettbewerb in den Regionen. Die Implikationen für die Kommunen liegen auf der Hand: Die Regionen müssen, wenn Wachstum geschaffen werden soll, Arbeitskräfte aus den wachsenden Zentralräumen und aus den umliegenden Regionen anziehen – um ihr endogenes Entwicklungspotenzial überhaupt erst nutzen zu können.
Zudem kann immer weniger davon ausgegangen werden, dass sich qualifiziertes Humankapital in den Regionen rekrutieren lässt, einerseits aufgrund des demografischen Wandels und der schrumpfenden Erwerbspotenziale in zahlreichen Regionen. Andererseits aufgrund sich verändernder Anforderungen an die Arbeitskräfte. Qualifiziertes Humankapital kann oftmals nur in urbanen Kommunen rekrutiert werden. Gerade die sich äußerst dynamisch entwickelnden wissensintensiven unternehmensbezogenen Dienstleister – und im Speziellen der Bereich Forschung und Entwicklung – sind urbane Branchen und auf städtische Infrastrukturen angewiesen, etwa auf Universitäten und Forschungseinrichtungen. Ohne ausreichende Erreichbarkeit werden periphere Regionen kaum von den urbanen Arbeitsmärkten profitieren können, kurzum: Die Anforderungen an die Infrastruktur steigen und Wachstum braucht Infrastruktur.
Letztlich geht der strukturelle Wandel in Österreich und in der gesamten Europäischen Union in Richtung immer wissens- und technologieintensiverer Produktion. Die Anforderungen an das Humankapital, an die Erwerbstätigen steigen kontinuierlich – das Gleiche gilt für jedes (regionale) Bildungssystem. Ausbildung, Bildung und Qualifizierung werden immer wichtiger, gerade angesichts von sich abzeichnenden distruptiven Veränderungen in der Produktion und in der Arbeitswelt – Auswirkungen der Digitalisierung (Industrie 4.0) auf die regionalen Arbeitsmärkte lassen sich kaum abschätzen beziehungsweise zeichnet sich kein eindeutiges Bild ab.
Verfügbarkeit von Humankapital als Standortfaktor
Die gestiegenen Möglichkeiten zur digitalen Vernetzung im Produktionsprozess und die damit einhergehende Verschmelzung von Produktionstechnik mit Informationstechnologie und Internet markieren zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Schwelle in die vierte industrielle Revolution, deren Umsetzung erst am Anfang steht. In diese Form der Digitalisierung und die damit verbundene durchgehende Vernetzung der industriellen Wertschöpfungsprozesse werden in Europa (und anderen hoch entwickelten Wirtschaftsstandorten) große Hoffnungen gesetzt, um Produktivität und Flexibilität zu steigern und so die Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Produktion zu erhöhen – und damit Beschäftigung und Wohlstand zu sichern.
Die Chancen und Risiken einer zunehmenden Digitalisierung von Produktions- und Arbeitsprozessen auf Produktivität, Wirtschaftsstruktur, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen werden seit einigen Jahren intensiv diskutiert. Dabei besteht auf der einen Seite die Möglichkeit, dass menschliche Tätigkeiten von Maschinen ersetzt werden (technologische Arbeitslosigkeit), andererseits kann durch (technologische) Entwicklungen neue Nachfrage generiert werden und damit Beschäftigung geschaffen werden. Die Verfügbarkeit von Humankapital auf der regionalen oder kommunalen Ebene wird zum entscheidenden Standortfaktor. Diese erhöhte Beschäftigtennachfrage tritt allerdings vermehrt für hochqualifizierte Arbeitskräfte vornehmlich mit IKT-relevanten Qualifikationen auf.
Eine weitere Digitalisierung der Produktions- und Arbeitsprozesse führt außerdem zu einer Veränderung der Arbeitsorganisation und damit vielfach zu erhöhten Anforderungen an die Flexibilität bei der Aufgabenerfüllung – mit entsprechenden Belastungen und Unsicherheiten für die Betroffenen. In jedem Fall verändern sich die Anforderungen an die Beschäftigten: neue Qualifikationen müssen erlernt werden, neue Prozesse werden implementiert werden. Aus Sicht der Unternehmen wird es unumgänglich sein, kontinuierlich zu qualifizieren und die Investitionen in Humankapital stetig zu steigern (die Bedeutung von „life-long-learning“ kann kaum hoch genug eingeschätzt werden, wie die entsprechenden übergeordneten Ziele der Europäischen Union verdeutlichen, zu ähnlichen Schlüssen kommen zahlreiche Studien der OECD).
Auf kommunaler Ebene werden sich Chancen, aber auch Herausforderungen auftun, wobei die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Bewältigung dieses strukturellen Wandels proaktiv gestaltet werden müssen. Dabei weitet sich das Konkurrenzumfeld der Regionen unter neuen Rahmenbedingungen zwar räumlich aus, aber regionale kompetitive Vorteile bleiben angesichts technologischer Weiterentwicklung, Veränderungen in geopolitischem Rahmen und Marktumfeld, sowie (nicht zuletzt) der Bemühungen um eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auch in Konkurrenzregionen im Zeitablauf nicht konstant, eine einmal erreichte Wettbewerbsposition kann damit nicht automatisch auch für die Zukunft als gesichert gelten.
Regionalpolitik braucht neue Instrumente
Hier gilt es anzumerken, dass die traditionellen Instrumente der Kohäsionspolitik an ihre Grenzen stoßen. In der Vergangenheit wurde versucht, durch Umverteilung die (wirtschaftliche) Entwicklung dieser Regionen gezielt zu fördern und Folgewirkungen ungleicher Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklungen auszugleichen bzw. abzumildern. Dies hat sich in vielen Fällen als teuer und wenig erfolgreich erwiesen, nicht zuletzt weil die Strahlkraft der Städte und ihre Innovationskraft schlicht unterschätzt wurden.
Auf kommunaler Ebene müssen neue Instrumente genutzt werden, die durch die Forcierung von Innovation direkt zu Wachstum und Beschäftigung beitragen. Eine explizit „ausgleichende“ Regionalpolitik muss vor dem Hintergrund neuer theoretischer und empirischer Erkenntnisse zu den (positiven) Wachstumswirkungen von Agglomeration und der geographischen Konzentration von ökonomischen Aktivitäten zunehmend als ineffizient abgelehnt werden. Die vielerorts angewandte Strategie, die negative Wachstumsdynamik durch spezifische Maßnahmen wieder in eine positive verwandeln zu wollen, war in der Vergangenheit nur in wenigen Fällen erfolgreich und scheint damit als allgemeingültige Empfehlung wenig erfolgversprechend.
Maßnahmen müssen die tragende Rolle der städtischen Agglomerationen als Treiber von Innovation, Kreativität und damit letztlich Wachstum nutzen. Bei guter Infrastrukturanbindung können letztlich auch die peripheren Regionen vom Wachstum in den Ballungsräumen profitieren.
Ein zentrales Problem tut sich auf, weil auf kleinräumiger kommunaler Ebene Entscheidungsträgern oftmals keine geeigneten, wissenschaftlich untermauerten Ansätze zur Verfügung stehen, die auf die spezifischen Ursachen der strukturellen Probleme, des demografischen Wandels und die sich verändernden Anforderungen an das Humankapital eingehen.
Regionen müssen sich vernetzen
Hier sind insbesondere kleine Strukturen gefordert. Die Vernetzungen zwischen den einzelnen Regionen müssen intensiviert und vertieft werden, Infrastrukturen müssen gemeinsam entwickelt und bereitgestellt werden. Zudem muss es in den Regionen in Abstimmung mit anderen Regionen gelingen, ein gemeinsames Bild zur künftigen Entwicklungsstrategie zu entwickeln. Spezialisierungsvorteile müssen genutzt werden, fehlende Potenziale sollen aus anderen Regionen „zugekauft“ werden (Komplementaritäten nutzen).
Die wissenschaftliche Herausforderung besteht darin, dass sich die einzelnen Regionen mit sehr spezifischen Herausforderungen konfrontiert sehen, Fallstudien können oftmals keine Abhilfe schaffen. Vielmehr müssen (auf Basis ökonometrischer Methoden) geeignete Prognosemodelle entwickelt werden, die regionsübergreifend zur Anwendung kommen können – dann werden die derzeitigen und kommenden globalen Herausforderungen auch lokal bewältigt werden können.