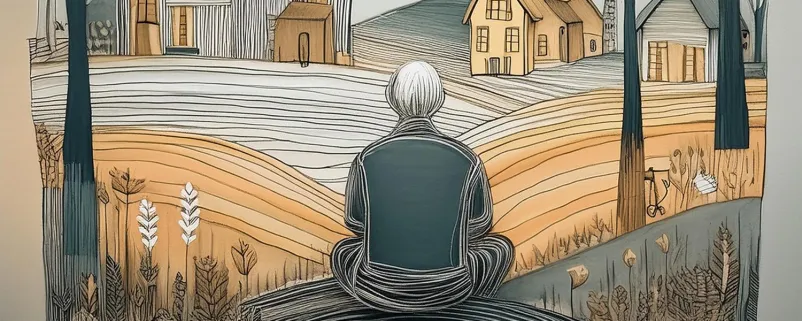
Demografie
Die alternde Gemeinde
Unsere Gesellschaft wird älter – besonders sichtbar ist das in vielen ländlichen Gemeinden. Der Beitrag fragt, wie Gemeinden altersfreundlicher gestaltet werden können, und stützt sich auf Interviews mit Hundertjährigen und kommunale Workshops aus dem Forschungsprojekt CLARA. Die zentrale Erkenntnis: Gutes Altern ist möglich – wenn Gemeinden soziale Teilhabe fördern, Barrieren abbauen und ältere Menschen als aktive Mitgestalter einbinden.
Statt Defizite zu betonen, zeigen die Autorinnen, wie Sichtbarkeit, intergenerationeller Austausch und barrierefreie öffentliche Räume das Altern im vertrauten Umfeld erleichtern. Maßnahmen wie „Tratschbankerl”, Fahrtendienste oder gemeinschaftliche Treffpunkte stärken soziale Netze – auch im hohen Alter. Das Ziel: Gemeinden, in denen Altern nicht Ausgrenzung bedeutet, sondern Verbundenheit, Mitgestaltung und Lebensqualität.
Für Österreich wird im Zeitraum von 2024 bis 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung bei Geburt erwartet – bei Frauen von derzeit 84,4 auf 89,1 Jahre (+4,7 Jahre) und bei Männern von 79,6 auf 85,6 Jahre (+6,0 Jahre) (eigene Berechnungen1). Damit geht ein Anstieg des Anteils von älteren Menschen – damit sind Personen über 60 Jahren angesprochen – einher. Etwa 28 Prozent der österreichischen Bevölkerung werden im Jahr 2050 über 65 Jahre alt sein (Statistik Austria 2024).
Auf Gemeindeebene sind aktuell zwei Aspekte des demografischen Wandels besonders spürbar. Einerseits eine schnellere bzw. stärkere Alterung der ländlichen Gemeinden, die sich vor allem durch den Wegzug von jüngeren Generationen erklären lässt. So wird bis 2050 vor allem in den Landeshauptstädten mit starkem Wachstum gerechnet (ÖROK 2021).
Dies führt dazu, dass ländliche Gemeinden heute im Durchschnitt älter sind als die größeren Städte, die einen Zuzug von jüngeren Menschen sowohl vom Umland als auch international verzeichnen. Andererseits zeichnet sich ein Trend zur Hochaltrigkeit ab, der den Gemeinden als aktuelle und zukünftige Herausforderung begegnet. So steigt mit dem demografischen Wandel auch der Anteil jener Personen, die ein sehr hohes Alter (80+, 90+, 100+) erreichen und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, pflegebedürftig zu sein. Dies stellt die Gemeinden vor allem hinsichtlich der Gesundheits- und Pflegeversorgung vor eine Herausforderung.
Veranschaulichen lässt sich dieser Trend anhand der Bevölkerungsentwicklung einer besonderen Gruppe: Menschen, die 100 Jahre oder älter sind. Weltweit nimmt die Anzahl der Personen, die über 100 Jahre alt werden, rasant zu. So geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davon aus, dass sich die globale Population von Hundertjährigen bis zum Jahr 2050 verzehnfachen wird (WHO 2015). Auch für Österreich wird eine Zunahme an Personen prognostiziert, die 100 Jahre und älter werden. Während 2024 etwa 1.700 Personen in Österreich 100 Jahre und älter waren, werden für 2050 etwa 5.000 Personen prognostiziert (eigene Berechnungen2).
Das folgende Kapitel befasst sich eingehend mit den Lebensbedingungen von Hundertjährigen in ihren österreichischen Wohngemeinden und mit der Frage, was auf Gemeindeebene getan werden kann, um Langlebigkeit zu Hause (sog. „Ageing in Place”) zu unterstützen.
Ein Fokus auf die Bevölkerungsgruppe der Hundertjährigen erscheint hier aus zwei Gründen sinnvoll: Einerseits hat die internationale Forschung darauf hingewiesen, dass Hundertjährige ein vergleichsweise hohes Maß an funktionaler Gesundheit, Resilienz und Lebensqualität haben (Borras u.a. 2020). Ihre Lebensbedingungen lassen also Schlüsse darauf zu, wie ein gutes und langes Leben unterstützt werden kann. Andererseits hat die internationale Forschung gezeigt, dass es nicht nur biologische und psychologische Aspekte sind, die dazu beitragen, dass Menschen 100 Jahre und älter werden, sondern auch regionale und kommunale Faktoren eine Rolle spielen: So zeigen Studien zu sogenannten Blue Zones, also Regionen, in denen bezogen auf die Gemeindebevölkerung überdurchschnittlich viele Hundertjährige leben, dass neben genetischen Faktoren auch eine gute soziale Einbindung in der Gemeinde zur Langlebigkeit beiträgt (Merino u.a. 2023; Buettner/Skemp, 2016).
Im Rahmen des Projekts „Centenarians in Lower Austria and the Communities of Longevity”3 – kurz CLARA – wurde untersucht, wie Hundertjährige in Österreich das Älterwerden in ihren Gemeinden erleben. Dazu wurden insgesamt 20 hundertjährige Personen, acht Angehörige und vier Pflegefachkräfte aus dem Umfeld dieser Hundertjährigen, sowie fünf Stakeholder auf Gemeindeebene interviewt. Anschließend wurden die Ergebnisse in vier Workshops mit Gemeindevertreter:innen diskutiert.
Langlebigkeit in der Gemeinde: Problemstellungen und Herausforderungen
Im Rahmen von CLARA konnten drei Herausforderungen zur Einbindung von Hundertjährigen in die Gemeinde identifiziert werden: Erstens (Un-)Sichtbarkeit des Alters in der Gemeinde, zweitens das Fehlen von intergenerationellem Austausch und drittens Zugangsbarrieren im öffentlichen Raum.
Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit des Alters in der Gemeinde
Im Rahmen der Interviews mit Hundertjährigen wurde deutlich, dass dem hundertsten Geburtstag in den jeweiligen Gemeinden eine besondere Rolle zukommt – insbesondere durch Besuche von Bürgermeister:innen und Gemeindevertreter:innen anlässlich dieses Geburtstags: „Zum Geburtstag kommen wir und bringen einen Präsentkorb und Blumen.” (Bürgermeister). Oftmals als „Ehrung” bezeichnet, standen die Besuche mit Aufmerksamkeiten wie Blumensträußen und Geschenken in Verbindung, und stellten eine Form der öffentlichen Anerkennung der individuellen Lebensleistung von Hundertjährigen dar.
Auch in der Forschung wird auf die Bedeutung solcher Würdigungen des sehr hohen Alters hingewiesen (Barken 2019). Dies scheint vor allem deswegen zentral, da immer wieder belegt wurde, dass negative Altersbilder nach wie vor die öffentliche Wahrnehmung des Älterwerdens prägen (Kessler 2023): So wird das Alter häufig einseitig als Lebensphase des Abbaus, des Rückzugs, der Einsamkeit oder der Hilfsbedürftigkeit dargestellt. Eine negative mediale Darstellung des Alters trägt auch zur Entstehung von Altersstereotypen bei (Wurm u.a. 2013). Weiters zeigen Studien auch, dass Medieninhalte nicht nur die Wahrnehmung älterer Menschen in der Gesellschaft prägen, sondern auch das Selbstbild älterer Menschen beeinflussen können (Wangler/Jansky 2021).
Die öffentlichen Feierlichkeiten von Hundertjährigen und ihrer Lebenserfahrung durch die Gemeinde bricht ein Stück weit mit dieser meist negativen öffentlichen Darstellung des Alters – anstatt Rückzug und die negativen Aspekte des Älterwerdens zu betonen, gaben die öffentlichen Feierlichkeiten zum hundertsten Geburtstag einen Einblick in die Erfolge und Potentiale der Langlebigkeit. Ein solches Sichtbar-Machen eines langen Lebens auf Gemeindeebene, so haben die Interviews gezeigt, geht über die individuelle Freude über Ehrungen und Anerkennung hinaus und schafft auch für andere (jüngere) Personen in der Gemeinde ein altersfreundliches Klima.
Als eine Herausforderung in diesem Kontext kann genannt werden, dass es häufig schwierig war, auch Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder (hohem) Pflegebedarf in solche Feierlichkeiten einzubinden. Indem vor allem autonome und „fitte” Hundertjährige öffentlich sichtbar gemacht werden, besteht die Gefahr, dass andere Lebensrealitäten, etwa von hochaltrigen Menschen mit Unterstützungsbedarf bzw. kognitiven und physischen Einschränkungen, unsichtbar bleiben (Ayalon/Lir 2022). Vor dem Hintergrund erscheint es wichtig, in solchen Feierlichkeiten die Vielfalt des Alters sichtbar zu machen und auch die Herausforderungen des Alters damit zu thematisieren.
Intergenerationeller Austausch
Hochaltrige Personen bleiben in Diskussionen zur Zukunft meist unsichtbar (Pin/Spini 2016): Wenn gesellschaftlich über die Zukunft gesprochen wird, kommen meist jüngere Menschen zu Wort. Dieser Umstand spiegelt ein weit verbreitetes Altersbild wider, indem ältere Menschen als Expert:innen für die Vergangenheit, allerdings nicht für die Zukunft wahrgenommen werden.
Im Rahmen der Interviews zeigte sich jedoch ein anderes Bild, denn Hundertjährige erzählten häufig, dass sie über die Zukunft ihrer Kinder, Enkel oder Urenkel nachdenken und sie der Klimawandel, künstliche Intelligenz und das aktuelle weltpolitische Geschehen beschäftigt. Besonders wichtig in diesen Zukunftsüberlegungen war der intergenerationelle Austausch, denn für die Umsetzung von Plänen im sehr hohen Alter war intergenerationelle Unterstützung zentral: „Ich überlege, was möglich ist. Das bespreche ich dann mit meinem Sohn. […] Wir haben schon einige Sachen vor. Und mit Hilfe meines Sohnes werden wir das auch umsetzen.” (Franz)
Die Forschung hat immer wieder die Bedeutung von sozialen Beziehungen für Lebensqualität, Selbstwirksamkeit und Wohlbefinden im Alter hervorgehoben (Antonucci u.a. 2010). Unterstützende Beziehungen innerhalb und außerhalb der Familie sind somit eine Voraussetzung dafür, dass hochaltrige Menschen Zukunft als gestaltbar erleben können – und Gemeinden können wichtige Orte sein, um soziale Beziehungen im sehr hohen Alter zu unterstützen. So zeigte sich, dass unterstützende, intergenerationelle Kontakte, die im Rahmen von Einrichtungen wie etwa dem Turnverein und der Kirche entstanden sind, auch im sehr hohen Alter bedeutend sind.
Zugangsbarrieren zum öffentlichen Raum
Viele Hundertjährige leben seit Jahrzehnten in ihren Gemeinden – viele sogar ihr Leben lang – wodurch die Gemeinde eine Konstante über ihren Lebenslauf darstellt. In den Interviews fanden sich entsprechend viele Erzählungen zur Verwurzelung im Ort, der Entwicklung der Umgebung und zu ihrem weitreichenden Wissensschatz über die lokale Geschichte, wie ein Bürgermeister erzählte: „Man erfährt auch sehr viel über die Stadt. 100 Jahre ist einfach eine sehr lange Zeit. […] Es ist interessant welche Geschäfte es gegeben hat, welche Familien es gegeben hat. Und da erfährt man zum Teil auch die Hintergründe dieser Familien.”
Dabei nutzen auch Hundertjährige den öffentlichen Raum in ihren Gemeinden: Sie suchen Grünanlagen, Plätze und Gaststätten auf, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten: „Wenn das Wetter gut ist, kann ich auf der Bank draußen sitzen und dann sehe ich die Leute vorbeigehen. (…) Dann sitzt noch jemand zu mir aufs Bänkchen und redet noch ein paar Worte mit mir.” (Irmgard).
Gleichzeitig zeigte sich hier in den Interviews, dass es in ländlichen Gemeinden oftmals an entsprechenden öffentlichen Räumen, die zum Verweilen und zu sozialem Austausch einladen, fehlt.
Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelten Leitlinien für Age-Friendly Rural and Remote Communities (WHO, 2008) bieten einen hilfreichen Rahmen, um diese Erfahrungen hochaltriger Menschen einzuordnen. Demnach sollten ländliche Gemeinden so gestaltet sein, dass sie die Teilhabe, Sicherheit und Lebensqualität älterer Menschen aktiv fördern – etwa durch barrierefreie Orte und Gebäude, zugängliche Verkehrssysteme, soziale Partizipationsmöglichkeiten sowie altersgerechte Gesundheits- und Unterstützungsangebote. Hervorgehoben wird außerdem die Bedeutung von Nachbarschaftshilfe, dezentralen Dienstleistungen und der Stärkung informeller Netzwerke in ländlichen Gemeinden. Studien zeigen, dass solche altersfreundlichen Umgebungen zur körperlichen und psychischen Gesundheit älterer Menschen beitragen, soziale Teilhabe stärken und sogar Einsamkeit reduzieren (Buffel u.a. 2012; Sixsmith u.a. 2014).
Stärken und Schwächen der Gemeinde
Im Rahmen der Workshops, in denen Ergebnisse mit Bürgermeister:innen, Stadträt:innen und Vetreter:innen unterschiedlicher lokaler Vereine diskutiert wurden, konnten Stärken und Schwächen der Gemeinde identifiziert werden. Generell wurde deutlich, dass sich die Gemeinden aufgrund des demografischen Wandels mit einem deutlichen Problem konfrontiert sehen, und zwar die bestehende Versorgungsqualität vor dem Hintergrund des Anstiegs des Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Dies betrifft sowohl die medizinische Versorgung als auch Plätze in Pflegeheimen, mobile Dienste und Angebote wie „Essen auf Rädern”.
Hinsichtlich der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit des Alters in der Gemeinde hat sich in der Diskussion gezeigt, dass die öffentliche Feier anlässlich des hundertsten Geburtstags und den damit verbundenen Ehrungen durch Bürgermeister:innen und Gemeindevertreter:innen eine wichtige Aufgabe der Gemeinden ist und bleibt. Gleichzeitig wurden Herausforderungen für Gemeinden hinsichtlich dieser Ehrungen deutlich – aufgrund von Umzügen im hohen Alter, etwa in ein Pflegeheim in einem anderen Ort, war es mitunter zeitaufwändig, mit hochaltrigen Menschen in Kontakt zu bleiben.
Hinsichtlich des intergenerationellen Austauschs wurde betont, dass es in den Gemeinden über Vereine, nachbarschaftliche Hilfen und engagierte Akteur:innen ein gutes Netz an intergenerationellen Sorgebeziehungen gibt. Sogenannte „Wunschfahrten” (wie jene vom Samariterbund4) und ähnliche Konzepte, die mittels Spenden und freiwilligem Engagement realisiert werden, sind bereits von einigen Gemeinden im Einsatz. In anderen Gemeinden fehlt es an altersspezifischen Unterstützungsangeboten sowie den zeitlichen und finanziellen Mitteln zur Umsetzung von intergenerationellen Projekten. Hier müssten in der Zukunft noch mehr Wege geschaffen werden, dass auch Personen mit Mobilitätseinschränkungen an diesen Angeboten teilnehmen können – etwa durch Fahrtendienste oder aufsuchende Angebote.
Hinsichtlich der Zugangsbarrieren zum öffentlichen Raum wurde von vielen Initiativen auf Gemeindeebene berichtet, die vom Anbringen eines Handlaufs oder dem Bereitstellen von Sitzgelegenheiten bis zur Entwicklung eines „Tratschbankerls” reichen. Während hier insbesondere budgetäre Mittel als Herausforderung wahrgenommen wurden, wurde auch betont, dass bereits kleine Verbesserungen einen bedeutenden Unterschied machen können. Der Austausch mit hochaltrigen Personen stellt auch einen fruchtbaren Ansatz dar, um konkrete Bedarfe zu erheben und passende Maßnahmen umzusetzen. Dies könnte etwa durch intergenerationelle Workshops oder Diskussionsrunden auf Gemeindeebene initiiert werden.
Entwicklungsszenarien und Empfehlungen für alternde Gemeinden
Abschließend haben Workshopteilnehmende Strategien zur Unterstützung des hohen Alters in den Gemeinden besprochen. Zentrales Element waren ehrenamtliches Engagement und Vereine, die dazu beitragen den Zusammenhalt über Generationen zu fördern. Eine Stärkung des Ehrenamts und von Projekten zum intergenerationalen Austausch, etwa Lesekreise, Geschichtsunterricht durch Zeitzeug:innen, oder Besuchsdienste haben sich als bewährte Strategien etabliert. Auch das Bereitstellen von Räumen durch die Gemeinde für Vereine, Veranstaltungen, Spielenachmittage und andere soziale Aktivitäten ermöglicht intergenerationelle Begegnungen und unterstützt so ein positives Bild des hohen Alters in der Gemeinde.
Hinsichtlich des öffentlichen Raums und dessen Gestaltung haben Teilnehmende der Workshops regelmäßige Assessments hervorgehoben, die eine Überprüfung aktueller Bedarfe – sowohl in sozialer als auch infrastruktureller Hinsicht – fokussieren. Diese können sowohl im Rahmen von Sprechstunden, aber auch durch aktive Kontaktaufnahme zuständiger Gemeindeangestellter mit hochaltrigen Bewohner:innen stattfinden. Maßnahmen sollten auf Zugänglichkeit und Vernetzung abzielen, um die Lebensqualität hochaltriger Menschen in ländlichen Gebieten zu sichern (Berg u.a. 2005). Konkret lassen sich gut erreichbare Ruhemöglichkeiten, soziale Treffpunkte (etwa in lokalen Gasthäusern) und der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel oder Fahrtendienste für ältere Menschen empfehlen.
3 Thesen
- Sichtbarkeit des Alters:
Während Ehrungen zu runden Geburtstagen beibehalten werden sollen, sollen auch Möglichkeiten gefunden werden dem hohen Alter abseits dieser Geburtstage Sichtbarkeit in ihrer Gemeinde zu verschaffen. Wie können positive Altersbilder in der Gemeinde gefördert und zugleich auf die Vielfalt des Alters hingewiesen werden? Als Praxisbeispiel kann hier das Linzer Projekt „Alter(n) in unserer Mitte”6 genannt werden, im Rahmen dessen ältere Menschen unterschiedliche Veranstaltungen der Stadt mitgestalten. Das wirkt auf mehreren Ebenen positiv: In der besseren Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, in der Förderung von Fähigkeiten und in der Sichtbarmachung des (hohen) Alters in der Gemeinde.
- Intergenerationeller Blick in die Zukunft:
Es sollte aktiv auf hochaltrige Personen in Gemeinden zugegangen werden und mit ihnen über ihre Pläne für die Zukunft gesprochen werden. Was brauchen Hochaltrige, um ihre Zukunft in der Gemeinde selbstbestimmt planen zu können? Wie kann intergenerationale Unterstützung in Ihrer Gemeinde aussehen? Ein gelungenes Beispiel aus der Praxis ist das Projekt „Heinzelmännchen Ingelheim”7. Dieses intergenerationelle Projekt richtet sich in erster Linie an ältere Menschen, die kurzfristige Unterstützung im Alltag benötigen.
- Partizipative Gemeindeentwicklung:
Hochaltrige Gemeindebewohner:innen sollten zu ihren ortsbezogenen Bedürfnissen gefragt werden. Welche Umsetzungen braucht es, damit die Gemeinde Bedürfnissen im hohen Alter (noch besser) gerecht werden kann? Wie kann der öffentliche Raum in der Gemeinde für das hohe Alter zugänglich gemacht werden? Wie und wo können Orte für Austausch geschaffen oder verbessert werden? Im Rahmen des steirischen Pilotprojekts „Ortsmitte”8 wurden altersfreundliche Begegnungsorte für ältere Menschen in drei steirischen Gemeinden geschaffen. Diese Treffpunkte wurden bedarfsorientiert gemeinsam mit den Beteiligten gestaltet und fokussieren Nachbarschaftskontakte.
- Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Kompetenzzentrum Gerontologie und Gesundheitsforschung
- Berechnung nach STATcube, basierend auf dem Bevölkerungsstand 2023
- Gefördert von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich unter der Projekt-ID: 100J-004
- https://www.samariterbund.net/nationale-internationale-projekte/samariter-wunschfahrt/
- ????
- https://www.linz.at/medienservice/2025/202501_129757.php
- https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-projekte/projekte-finder/projekt/nachbarschaftshilfe-heinzelmaennchen
- https://styriavitalis.at/information-service/projektarchiv/ortsmitte
Literatur
Antonucci, T. C., Ajrouch, K. J., & Birditt, K. S. (2010): The Convoy Model: Explaining Social Relations From a Multidisciplinary Perspective. The Gerontologist, 50(5), 495–508.
Ayalon, L., & Lir, S. A. (2022): “The Internal Police Officer Has Not Retired but Has Slowed Down”: Israeli Women Reframe Their Aging Experiences in the Second Half of Life. Journal of Applied Gerontology, 41(3), 847-854. https://doi-org.uaccess.univie.ac.at/10.1177/07334648211061477 (Original work published 2022)
Barken, R. (2019): “Old age” as a social location: Theorizing institutional processes, cultural expectations, and interactional practices. Sociology Compass. https://doi.org/10.1111/SOC4.12673
Berg, A., Fiske, M., & Rieger, H. (2005): Rural Aging and Social Networks. Journal of Rural Social Sciences, 20(2), 50-70.
Borras C., Ingles M., Mas-Bargues C., Dromant M., Sanz-Ros J., Román-Domínguez A., Gimeno-Mallench L., Gambini J., Viña J. (2020). Centenarians: An excellent example of resilience for successful ageing. Mech Ageing Dev. 186:111199. doi: 10.1016/j.mad.2019.111199. PMID: 31899226.
Buettner, D., & Skemp, S. (2016): Blue Zones: Lessons from the world’s longest lived. American Journal of Lifestyle Medicine, 10(5), 318–321. https://doi.org/10.1177/1559827616637066
Buffel, T., Phillipson, C., & Scharf, T. (2012): Ageing in urban environments: Developing ‚age-friendly’ cities. Critical Social Policy, 32(4), 597–617. https://doi.org/10.1177/0261018311430457
Diehl, M., Brothers, A. & Wahl, H. W. (2021): Self-perceptions and awareness of aging: past, present, and future. Handbook of the Psychology of Aging. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-816094-7.00001-5
Hahmann, J. (2019): Gemeinschaft, Netzwerke und soziale Beziehungen im Alter. In: Schroeter, K., Vogel, C., Künemund, H. (eds) Handbuch Soziologie des Alter(n)s. Springer Reference Sozialwissenschaften. Springer VS, Wiesbaden. https://doi-org.uaccess.univie.ac.at/10.1007/978-3-658-09630-4_28-1
Heckhausen J., Dixon R. A., Baltes P. B. (1989): Gains and losses in development throughout adulthood as perceived by different adult age groups. Developmental Psychology, 25(1), 109–121. https://doi-org.uaccess.univie.ac.at/10.1037/0012-1649.25.1.109
Merino, J., Khera, A. V., Keller, M. C., & Carrasquillo, O. (2023): Genetics, lifestyle, and longevity: Insights from centenarian studies and Blue Zones research. Nature Reviews Genetics, 24(2), 123–140. https://doi.org/10.xxxx/nrg.2023.xxxx
ÖROK. (2021): ÖROK-REGIONALPROGNOSEN 2021–2050: BEVÖLKERUNG. https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/publikationen/Schriftenreihe/212/OEROK_212_Kurzfassung.pdf
Pin, S. & Spini, D. (2016): Meeting the Needs of the Growing Very Old Population: Policy Implications for a Global Challenge. Journal of Aging & Social Policy, 28, 218 - 231. https://doi.org/10.1080/08959420.2016.1181972
Sixsmith, A., Sixsmith, J., Fänge, A. et al. (2014): Healthy ageing and home: The perspectives of very old people in five European countries. Social Science & Medicine, 106, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.01.006
Statistik Austria. (2024): Bevölkerungspyramide Österreich 1952-2100 Prognose. https://www.statistik.at/atlas/bev_prognose/#!y=2050
Wangler, J. & Jansky, M. (2021): Wie wirken mediale Altersbilder auf ältere Menschen? – Ergebnisse einer Rezeptionsstudie. Z Gerontol Geriat 54, 676–684. https://doi-org.uaccess.univie.ac.at/10.1007/s00391-020-01745-y
World Health Organization. (2008): Age-Friendly Rural and Remote Communities – A GuideGlobal age-friendly cities: a guide. World Health Organization. https://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/alt-formats/pdf/publications/public/healthy-sante/age_friendly_rural/AFRRC_en.pdfhttps://iris.who.int/handle/10665/43755
Wurm, S., Berner, F. & Wahl, H.W. (2013): Altersbilder im Wandel. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/153117/altersbilder-im-wandel/










