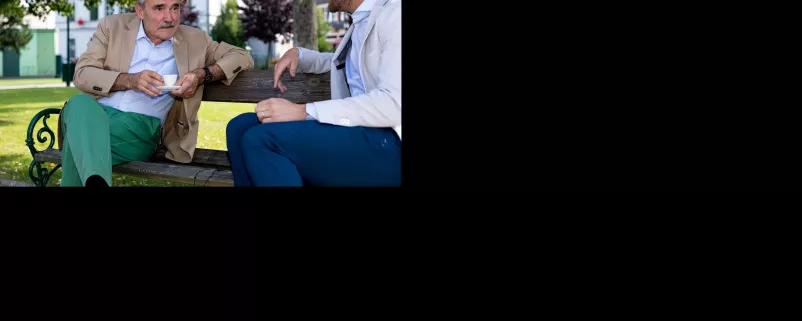
Alois Steinbichler im Gespräch mit dem Chef des Österreichischen Kommunalverlags, Michael Zimper.
Die Digitalisierung ändert das Bankgeschäft
Rochade an der Spitze der Kommunalkredit. Alois Steinbichler wechselt nach zehn Jahren vom Vorstand in den Aufsichtsrat. Wie es dem „Retter der Kommunalkredit“ und maßgeblichen Unterstützer der Kommunalen Sommergesprächen damit geht, was sich ändert und worauf er stolz ist, darüber spricht er im Interview in Bad Aussee.
Sie wechseln nach 40 Jahren als Banker, davon zehn Jahre als Chef der Kommunalkredit, in den Aufsichtsrat – also von einem operativen zu einem eher strategischen Part. Was wird sich für Sie ändern?
Als ich Ende 2008 in die Kommunalkredit geholt wurde, haben wir für die Phase der Restrukturierung einen klaren strategischen Plan aufgestellt. Rückblickend kann man sagen: Der Plan ist sehr gut aufgegangen. Jetzt, wenn ich die operativen Zügel übergebe, übernehme ich als Aufsichtsrat eine kontrollierende Funktion, werde mich aber weiterhin der Kommunalkredit verbunden fühlen.
Wie hat sich in diesen 40 Jahren das Selbstverständnis des Bankers in der Zeit gewandelt?
Es hat sich in mehreren Aspekten massiv gewandelt. Erstens haben wir uns aus einer sehr regulierten Umgebung bis etwa Mitte der 1990er Jahre in eine völlig de-regulierte Welt bewegt. Das war mit ein Grund für die Finanzkrise des Jahres 2007/2008. In den vergangenen acht bis zehn Jahren gab es daraufhin eine massive Re-Regulierungs-Welle.
Eine zweite Änderung ist ebenso massiv, aber technologisch bedingt – die Digitalisierung. Wir sind mittlerweile bei der Blockchain als relevantes Thema angekommen. Das operative Transaktionsgeschäft für Banken ist strategisch fast obsolet, weil sich durch die Digitalisierung sehr viele Dinge geändert haben und weiter ändern werden.
Verliert man durch den Verlust des Zahlungsgeschäfts nicht auch den Kontakt zum Kunden?
Das glaube ich nicht. Transaktionen entstehen ja aus Kundenbeziehungen, nur die Kanäle haben sich geändert. Ob das aber allen Banken gelingt, sich anzupassen, ist eine offene Frage. In dieser ersten Phase erleben wir natürlich eine „Störung der tradierten Geschäftsfelder“.
Gleichzeitig ist die Digitalisierung eine Chance. Nehmen wir unser eigenes Beispiel Kommunalkredit: Wir sind jetzt aufgrund digitaler Lösungen in der Lage, Kunden über KOMMUNALKREDIT INVEST ein Angebot für Einlagen zu machen. Das wäre ohne die Digitalisierung nicht möglich gewesen.
Sie haben die Kommunalkredit in einer stürmischen Zeit übernommen – überhaupt hat die Finanzkrise von 2008 tiefe Spuren hinterlassen. Was war für Sie die größte Herausforderung? Und worauf sind Sie am meisten stolz?
Stolz bin ich, dass es uns im Team gelungen ist, diese scheinbar aussichtslose Situation über längere Zeit und mit Unterstützung der öffentlichen Hand ins Positive zu drehen. Das hat es ermöglicht, dass am Ende des Restrukturierungsprozesses ein „operativer Körper“ übriggeblieben ist, der Steuern zahlt, 270 qualifizierte Arbeitsplätze bietet und der der Republik aus der Teilprivatisierung noch einen Verkaufserlös sichern konnte.
Die wahrscheinlich größten Herausforderungen waren zu Beginn, zwischen November 2008 und März 2009 eine Refinanzierungslücke von neun Milliarden zu schließen. Das ist wirklich viel Geld. Weiters schien es anfangs aussichtslos, eine positive Fortbestandsprognose seitens der EU-Wettbewerbskommission zu bekommen und die Auflösung der Bank war schon verkündet. Unser strategisches und operatives Konzept wurde wirklich auf Herz und Nieren und alle sonstigen Organe geprüft; wir konnten damit bestehen. Im Rückblick sehr erfreulich und auch international sehr positiv beachtet.
Wie ändert sich das Geschäftsmodell der Kommunalkredit in nächster Zeit?
Unser Geschäftsmodell entspricht den strategischen Prämissen des Restrukturierungsmodells, das wir bei der europäischen Wettbewerbskommission abgegeben haben: weg vom „Public Finance“-Geschäft – sprich Budgetfinanzierung – hin zur Finanzierung von fokussierten Infrastrukturprojekten im öffentlichkeitsnahen Bereich.
Erweitert hat sich lediglich die geografische Breite. Wir sind jetzt in Kerneuropa aktiv und selektiv auch in Ländern wie Spanien und Zentraleuropa. Der Fokus liegt immer auf Infrastrukturprojekten wie öffentlichen Gebäuden, Schulen, Spitälern, Pflegeeinrichtungen, erneuerbarer Energien und Verkehrsinfrastruktur.
Ab welchen Investitionsvolumen kann sich eine Gemeinde an die Kommunalkredit wenden?
Wir beginnen bei Volumina von fünf bis zehn Millionen. Wir sind aber bestrebt, Ansätze zu finden, kleinere Projekte, beispielsweise in Gemeindeverbänden, zu bündeln. Anzudenken wäre hier, ähnlich wie bei Abwasser- und Abfallverbänden, die Gründung von Schulerrichtungsverbänden etc.
Das sind jetzt die 13. Kommunalen Sommergespräche. Das Format ist im Wesentlichen gleichgeblieben. Sollte man nicht an einen Relaunch denken?
Die Kommunalen Sommergespräche haben zwei Ziele. Einerseits die Befassung mit einem ausgewählten kommunalrelevanten Thema – eine tiefgehende Analyse. Und zweitens, daraus konkrete „Take-aways“ zu definieren, damit die Teilnehmer konkrete Erkenntnisse mitnehmen können.
Die Umsetzung kann nicht hier vor Ort stattfinden, sondern erst im Nachgang: Damit meine ich das Anstoßen konkreter Maßnahmen auf Basis dieser Analyse. Natürlich fragen wir uns immer, ob noch alles passt. Aber das Interesse und das positive Feedback der Teilnehmer zu den Themen, der Art der Aufbereitung und dem Ambiente in Bad Aussee hat uns überzeugt, die Kommunalen Sommergespräche in dieser erfolgreichen Form fortzuführen.
Das heurige Thema „Aktives Altern und Pflege“ brennt besonders unter den Nägeln. Wie ist Ihr Zugang zu diesen Fragen?
Da wir alle länger und gesünder leben, drängen sich konkrete Fragen auf. Tradierte Bezeichnungen wie „Pensionierung“ oder „Ruhestand“ sind in meinem Verständnis anachronistisch. Wir bleiben länger aktiv und sind biologisch, Gott sei Dank, jünger als früher.
Natürlich stellt sich die Frage, ob wir uns den bisherigen Zugang weiter leisten können. Wenn wir uns die Pensionssysteme anschauen, sehen wir bereits jetzt hohen Zuschussbedarf aus dem Budget; über das tatsächliche Pensionsantrittsalter muss nicht nur geredet werden. Wir werden tatsächlich länger arbeiten müssen. Und die Pflegesysteme müssen bei steigender Altersbevölkerung gesamthaft betrachtet werden. Derzeit ist das sehr fraktioniert.
2017 war die Digitalisierung Thema der Kommunalen Sommergespräche. Heuer hat der „Pflegeroboter“ Emma die Veranstaltung eröffnet. Werden wir die Personalprobleme im Pflegebereich mit Maschinen lösen?
Nein. Maschinen werden die Arbeit der pflegenden Menschen unterstützen, aber sie werden menschliche Pflege nie ersetzen. Vielleicht wird ein Pflegeberuf mit Robotern attraktiver, weil er einfacher wird, z. B. beim Heben oder Umbetten.
Bei Ihrem Vortrag fiel das Wort „Handlungsrealität“. Da ging es um die Zuständigkeit für die Pflege, die in Österreich nicht eindeutig ist. Und es meldet sich auch niemand freiwillig, der sich dieses Themas annehmen würde. Wie kann man so ein Problem lösen?
Die Zuständigkeiten sind sehr fraktioniert. Wir reden hier über 4,5 Milliarden Euro Pflegegeld aus dem öffentlichen Budget. Diese erfassen aber weder den Großteil der Leistungen, die von Angehörigen erbracht werden, noch karitative Leistungen von Hilfsorganisationen. Dies strukturiert zu erfassen, ist derzeit schwierig. Daraus entsteht eine Zuschuss- oder Fördermentalität. Damit entsteht ein Wettbewerb um Mittel – wie in jedem Budgetprozess. Eine Gesamtschau ist schwierig. Wir treffen hier wieder auf die föderale Struktur zwischen Bund, Länder und Kommunen. Eine gesamthafte Betrachtung des Themas wäre sehr sinnvoll.
Wie würde denn ein Manager so ein Problem, das niemanden ganz gehört und das auch niemand ganz haben will, lösen?
Zunächst muss man den Kern des Problems definieren. Beispielsweise haben wir ein halbgeschlossenes Auge in der 24-Stunden-Pflege, wo angeblich 60.000 Personen in über 600 Vermittlungsagenturen aktiv sind; es gibt unterschiedliche Standards in den Bundesländern; unterschiedliche Verrechnungssätze; es gibt teilweise Parallelaspekte bei mobilen Dienstleistungen.
Als Manager würde man fragen: Welche langfristigen Entwicklungen müssen wir abdecken? Welche Ressourcen brauchen wir für welche Standards, welche Kapazitäten haben wir schon? Was sind die Kosten, wer bezahlt dafür? Ähnlich einem „Business Case“. Oder man arbeitet mit einer Chaos-Theorie und sagt, in Summe funktioniert es doch irgendwie. Aber nachdem der Bedarf ansteigen wird, ist es sicher sinnvoll, das Thema fokussiert zu betrachten.
Wenn Sie jetzt als Manager eine Entscheidung treffen müssten, wie würde die ausfallen?
Ich würde die Beteiligten an den Tisch holen und das in einem vordefinierten Zeitraum durchdeklinieren. Danach –sagen wir, in sechs Monaten – sollten wir wissen, wie es für die nächsten zehn Jahre gehen kann.





